Gewollte Ungleichheit
Die vorherrschende Gesellschaftsordnung und die Suche nach Sinn
In seinem neuen Buch Kapital und Ideologie plädiert der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty für einen radikalen ideologischen Umschwung, um der Ausweitung der globalen Ungleichheit zu begegnen.
Kapital und Ideologie
Thomas Piketty, aus dem Französischen von André Hansen, Enrico Heinemann, Stefan Lorenzer, Ursel Schäfer und Nastasja S. Dresler, C. H. Beck, München 2020
„Jede menschliche Gesellschaft muss ihre Ungleichheiten rechtfertigen. Sie muss gute Gründe für sie finden, da andernfalls das gesamte politische und soziale Gebäude einzustürzen droht.“ So beginnt Thomas Pikettys Kapital und Ideologie, sein nach Das Kapital im 21. Jahrhundert (2014) mit Spannung erwartetes neues Buch.
Piketty, einer der bekanntesten Wirtschaftswissenschaftler der Gegenwart, ist Professor an der École des Hautes Études en Sciences Sociales und an der École d’Économie de Paris. In seinem über 1200 Seiten starken Buch erhebt er Anklage gegen die Ideologie – sie schaffe und zementiere wirtschaftliche Ungleichheit.
Das Buch passt in unsere Zeit. Rechtslastige Politik, Populismus und der Aufstieg von Autokraten, so Piketty, seien Anzeichen einer bereits weltweit vorhandenen Überzeugung, dass Strukturen, die verschiedene Ungleichheiten aufrechterhalten, niedergerissen werden müssen; und er warnt, bei einer Katastrophe könnten Probleme wie Zuwanderung oder Klimawandel die Sorgen um extreme Ungleichheit verschärfen und zu einer „neuen Politik“ führen.
In der Hoffnung, einen vernünftigen Weg nach vorn zu finden, wendet er sich in dem aktuellen Buch der Geschichte zu. Doch kann eine erneute Betrachtung oder Neudefinition alter politischer Ideologien eine dauerhafte, stabile Lösung bringen?
Realitäten moderner Ungleichheit
Auf seiner Suche nach Antworten auf eines der größten Probleme, das die Menschheit heute plagt, durchforstet Piketty 500 Jahre weltweiter Ungleichheit. Der erste Teil des Buches analysiert Gesellschaften der vormodernen Zeit mit ihren „drei unterschiedlichen sozialen Gruppen (. . .) Klerus, Adel und Dritter Stand“; der zweite Teil untersucht die Sklavenhalter- und Kolonialgesellschaften; der dritte Teil behandelt „die große Transformation im 20. Jahrhundert“, und der vierte Teil analysiert die Entwicklungen politischer Parteien und Bewegungen in einigen wichtigen Demokratien der Welt seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, gefolgt von Pikettys Gedanken, wie es nun weitergehen könnte.
Wie man erwarten konnte, zeigt Pikettys Untersuchung auf, dass heute weltweit gravierende Ungleichheiten fortbestehen. Er erkennt zwar Fortschritte in Bereichen wie Gesundheit und Bildung, merkt aber an, dieser Erfolg maskiere häufig „enorme Ungleichheiten und Schwächen. 2018 lag die Säuglingssterblichkeit, also die Sterblichkeit von Kindern unter einem Jahr, in den reichsten europäischen, nordamerikanischen und asiatischen Ländern bei 0,1 %, in den ärmsten afrikanischen Ländern aber bei fast 10 %.“ Im selben Jahr stieg das weltweite Durchschnittseinkommen auf „tatsächlich 1000 Euro pro Monat und Kopf, aber während es sich in den ärmsten Ländern auf 100–200 Euro beschränkte, lag es in den reichsten Ländern bei 3000–4000 Euro“ – noch höher in bestimmten Ölmonarchien und „in einigen kleinen Steuerparadiesen, die manche (nicht ohne Grund) verdächtigen, den Rest des Planeten zu plündern“.
„Jede menschliche Gesellschaft muss ihre Ungleichheiten rechtfertigen, und in solchen Rechtfertigungen steckt immer beides: Wahrheit und Übertreibung, Einbildungskraft und Niedertracht, Idealismus und Egoismus.“
Im Folgenden zeigt der Wirtschaftswissenschaftler auf, dass in den letzten Jahrzehnten ein kleiner Teil der Bevölkerung vieler Länder von einem immer größeren Anteil des Gesamteinkommens profitiert hat. 2018 entfielen auf die 10 % der Spitzenverdiener in Indien, den USA, Russland, China und Europa 35–55 % des Gesamteinkommens in ihrer Region – 1980 waren es noch 25–35 % gewesen. Die 50 % mit den niedrigsten Einkommen hatten 2018 einen Anteil von nur noch 15–20 % am Gesamteinkommen, gegenüber 20–25 % im Jahr 1980. In den USA sank der Einkommensanteil der untersten 50 % auf 10 % des Gesamteinkommens – für den künftigen sozialen Zusammenhalt verheißt das nichts Gutes.
Diese Zahlen legen den Schluss nahe, dass ein Bruchteil der Bevölkerung „wahrlich einen Elefantenanteil des Wachstums ergattert“ hat.
Die Wahl der Ideologie
Piketty argumentiert weiter: „Die Ungleichheit ist keine wirtschaftliche oder technologische, sie ist eine ideologische und politische Ungleichheit.“ In jeder Epoche der Geschichte habe es mehrere von Menschen entwickelte Ideologien gegeben, und in jeder Epoche habe die Ideologie, die sich durchgesetzt habe unweigerlich dazu gedient, Ungleichheit zu rechtfertigen und zu stärken.
Die heute vorherrschenden demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften erzählen uns zum Beispiel, die aktuelle Ungleichheit sei auf der Basis von Unternehmergeist und Meritokratie gerechtfertigt, „da sie sich aus einem frei gewählten Verfahren ergibt, in dem jeder nicht nur die gleichen Chancen des Marktzugangs und Eigentumserwerbs hat, sondern überdies ohne sein Zutun von dem Wohlstand profitiert, den die Reichsten akkumulieren, die folglich unternehmerischer, verdienstvoller, nützlicher als alle anderen sind“.
Piketty bezeichnet dies als „meritokratische Heuchelei“, weil das System nicht allen gleichberechtigten Zugang bietet, auch wenn seine Hauptnutznießer das gern glauben möchten. Außerdem werde mit zweierlei Maß gemessen, da „die meritokratische Ideologie, so wie sie heute existiert, mit einer Glorifizierung von Unternehmern und Milliardären einhergeht“, sofern es sich um die „freundlichen kalifornischen Unternehmer“ handelt – und nicht um die „bösen russischen Oligarchen“. Auch bei den Ersteren gibt es „quasi monopolistische Konstellationen, von denen sie profitieren; Rechts- und Steuersysteme, die die größten Akteure begünstigen; die private Aneignung öffentlicher Ressourcen und so weiter“, doch sehe die westliche Meritokratie darüber hinweg. Dass die Ungleichheit unter der vorherrschenden kapitalistischen „Erzählung“ nachweislich nur größer geworden ist, führt ihn dazu, das „Scheitern der Sozialdemokratie“ zu erklären.
„Ein solches Regime der Rechtfertigung von Ungleichheiten, das hyper-meritokratisch und westzentriert zugleich auftritt, wirft ein Licht darauf, wie unüberwindbar das Bedürfnis menschlicher Gesellschaften ist, ihren Ungleichheiten einen Sinn zu geben, mitunter auch jenseits aller Vernunft.“
Dieses meritokratische System, so Piketty, sei keine Erfindung des 20. Jahrhunderts: Politische Macht und Eigentum (Land, Naturressourcen, Geld, Immobilien, Menschen usw.) sind seit den vormodernen bis hin zu den modern Gesellschaften eng miteinander verbunden. Aus seiner Sicht seien Systeme, die Ungleichheit fördern, schon immer freiwillig gewählt worden, weil diese sozialen und historischen Konstrukte „hochgradig von den sozialen, fiskalischen oder juristischen Begriffen abhängen, die Gesellschaften bilden, um sich selbst zu beschreiben“.
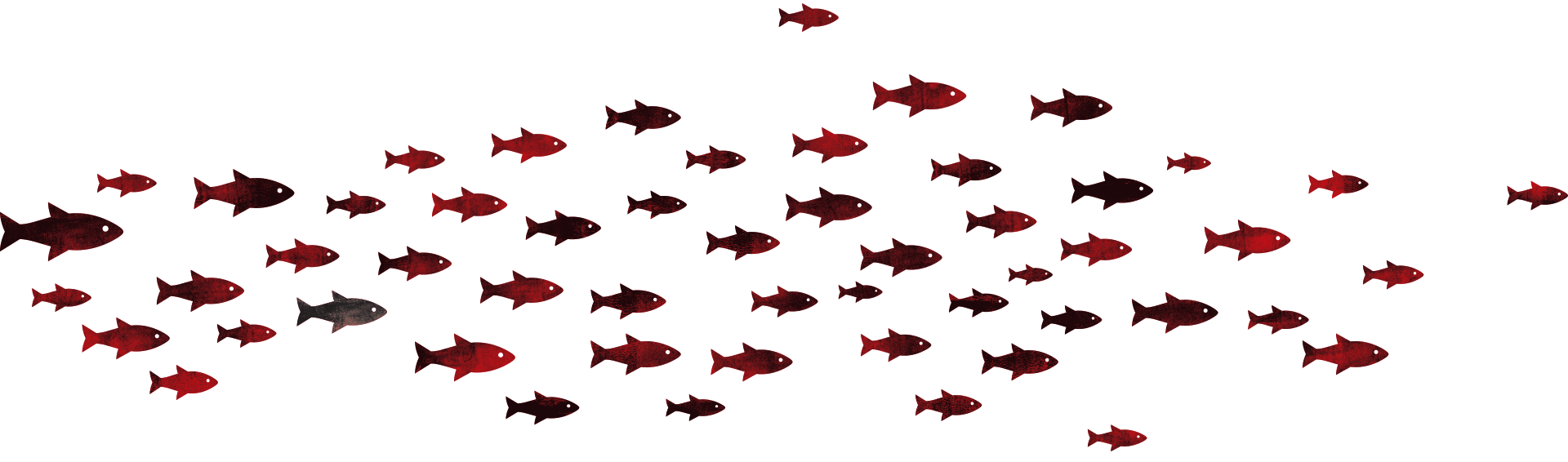
Hyperkapitalismus und was danach kommt
Die vielleicht bedenklichste Tatsache, die Piketty aufzeigt, ist das Ausmaß, in dem die Ungleichheit in aller Welt zugenommen hat. Insbesondere die USA seien das am wenigsten egalitäre Land in der entwickelten Welt. Im Westen verfolgt er den Trend zurück zu den 1970er- und 1980er-Jahren mit der „konservativen Revolution“ von Ronald Reagans Republican Party und Margaret Thatchers Conservative Party. Ihre Politik bewirkte starke Steuersenkungen für die Spitzenverdiener in den USA und Großbritannien, kombiniert mit einer erheblichen sozialen und finanziellen Deregulierung. Piketty vermutet, dass die Folgen vielleicht erst jetzt weltweit in vollem Umfang greifen.
Wie viele Kommentatoren der Linken sieht Piketty jene Zeit als gescheitertes Experiment. Das Produktivitätswachstum beider Länder sei in den Jahrzehnten vor 1990 höher gewesen als danach, was Zweifel daran aufwerfe, dass Steuersenkungen für die Reichen zu Wirtschaftswachstum führen. Sie hätten vielmehr erheblich dazu beigetragen, dass die Kluft der Ungleichheit in den letzten 40 Jahren immer breiter geworden sei, wobei „diese wachsende Ungleichheit vor allem zu Lasten der ärmsten 50 % ging“.
Aus Pikettys Sicht war „das dramatische Scheitern des kommunistischen Experiments in der Sowjetunion“ ein Hauptfaktor für den Aufstieg des Wirtschaftsliberalismus. Der Fall der Berliner Mauer löste eine „antikommunistische Euphorie“ aus, die es möglich machte, dass sich eine neue, hyperkapitalistische Digitalwirtschaft praktisch ungehemmt über die ganze Erde ausbreitete. Den sozialdemokratischen Parteien gelang es nicht, ihrerseits eine glaubhafte Alternative anzubieten. Stattdessen, so Piketty, bestätigten und verewigten die Regierungen von Bill Clinton und Barack Obama einige Aspekte von Reagans Wirtschaftspolitik, und der Schwung dieser Euphorie war so stark, dass neues Denken über das Thema erst nach dem Totalschaden der Wirtschaftskrise von 2008 wieder zum Vorschein kam.
All dies habe die Unter- und Mittelschichten verbittert und zu einer Verschiebung der Wählergunst geführt. Die Zuspitzung dieser Faktoren, so Piketty, kam 2016 mit der Entscheidung der Briten, die Europäische Union zu verlassen (Brexit), und der Wahl Donald Trumps in den USA. Die Finanzkrise von 2007–2008, schreibt er, hatte „ihren Ursprung in übermäßiger Deregulierung des privaten Finanzsektors“. Bei Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks, denen es an Vermögen, hohen Einkommen oder hohen Studienabschlüssen fehlt, könne ein Gefühl des Abgehängtseins aufgekommen sein, das durchaus die aktuelle identitäre Politik und Antizuwanderungsstimmung angeheizt haben könnte.
Die boomende Weltbevölkerung vergleicht Piketty mit einem brodelnden Topf, der ohne das richtige Eingreifen unweigerlich überkochen werde. Die geförderten und privilegierten Klassen werfen den Armen ihre Armut vor und diskriminieren aufgrund von Rasse, Religion oder Status. Sie diskriminieren Wohnungslose und Zuwanderer auf eine Weise, „deren gewaltsamer Charakter zu den meritokratischen Ammenmärchen so recht nicht passen will und uns vielmehr in die Nähe der brutalsten Formen vergangener Ungleichheiten rückt, mit denen wir doch nichts gemein haben wollen“. Er sieht eine von Angst getriebene populistische Kehrtwende rückwärts gegen diese „niedrigeren“ Menschenklassen als etwas real Mögliches, „wie es im Europa der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu beobachten war und in diesem beginnenden 21. Jahrhundert in den verschiedensten Teilen der Welt abermals zu beobachten ist“.
Ein neues Narrativ
Die Ära des Hyperkapitalismus und eine globalisierte Digitalwirtschaft haben eindeutig dazu beigetragen, einigen Ländern aus der Armut herauszuhelfen. Doch die Globalisierung hat nicht verhindert, dass sich der kleinste Prozentsatz der Bevölkerung die Mehrheit des Vermögens besitzt. Pikettys Lösungsvorschlag lautet: progressive Besteuerung und Vermögensumverteilung. Er glaubt, dass wir aus postkolonialen Diskussionen über Föderalismus im Kontext regionaler und transnationaler Demokratien (wie der Europäischen Union) viel lernen könnten. Unser globales Dorf sei zu „einer immer stärker vernetzten globalen ideologischen Landschaft“ geworden, und der Rahmen, in dem politisches Handeln imaginiert werde, müsse permanent neu gedacht werden.
Er betont: „Wer glaubt, man könne eines Tages an eine mathematische Formel, einen Algorithmus, ein ökonometrisches Modell die Entscheidung darüber delegieren, wie das «gesellschaftlich optimale» Ungleichheitsniveau und die Institutionen, die es verbürgen, aussehen sollten, kann nur enttäuscht werden. Dazu wird es nie kommen, und das ist gut so. Nur die offene, in einer natürlichen Sprache (oder vielmehr in verschiedenen Sprachen, was einen erheblichen Unterschied macht) geführte Diskussion lässt die Nuancen und Feinheiten zu Wort kommen, die es braucht, um solche Entscheidungen abzuwägen.“
„Die Geschichte der menschlichen Gesellschaften lässt sich als Suche nach Gerechtigkeit begreifen.“
Piketty glaubt, dass jede denkbare Lösung die lange Geschichte der Ungleichheit im Auge behalten wird. Wir sollten auf die Momente schauen, in denen politische Prozesse – auch Revolutionen – Veränderungen bewirkt haben: „das allgemeine Wahlrecht, die kostenlose Schulbildung und die Schulpflicht, die allgemeine Krankenversicherung und die progressive Steuer“. In einer Welt, wo rechtslastige Staats- und Wirtschaftspolitik die letzten Jahrzehnte beherrscht habe, sei dies tatsächlich die andere Seite der ideologischen Medaille; allerdings habe es keine breite Zustimmung gefunden. Bis jetzt konnte es, so Piketty, nichts dagegen ausrichten, „dass in ganz unterschiedlichen Gesellschaften, zu allen Zeiten und unter allen Breitengraden die Eliten es darauf anlegen, Ungleichheiten zu naturalisieren, also so zu tun, als hätten diese natürliche und objektive Gründe.“
Von Habgier spricht der Wirtschaftswissenschaftler in seinem Buch kaum, doch scheint dieser außerordentlich unattraktive menschliche Wesenszug der Kern des Problems zu sein: Geldgier, Besitzgier, sogar Machtgier oder Statusgier. Genug scheint nie genug, und so beginnt ein nie endendes Streben nach mehr von einem oder von allem – oft auf Kosten anderer, wodurch die Kluft der Ungleichheit noch größer wird.
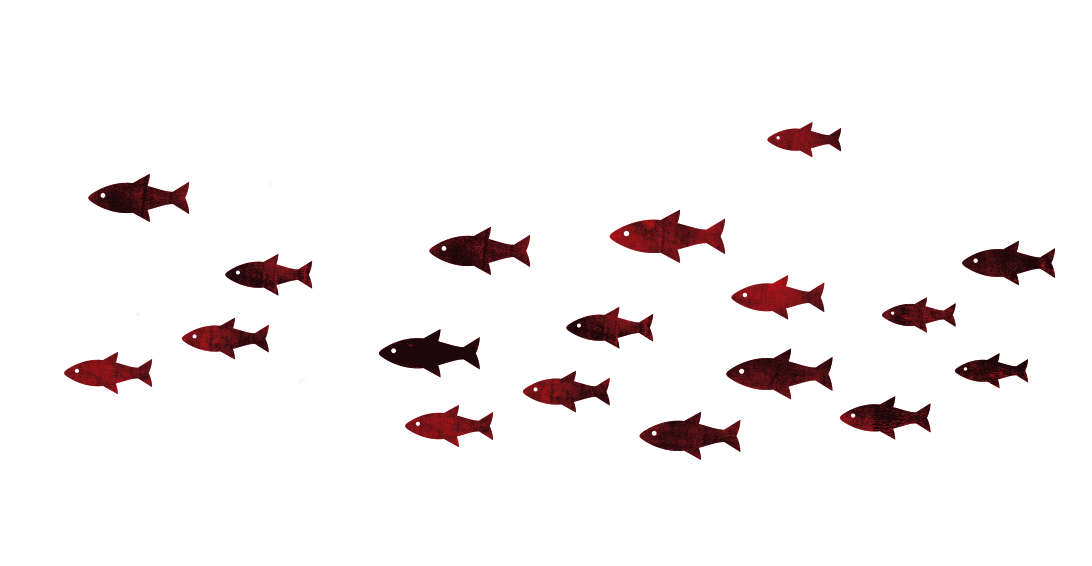
Natürlich ist Ungleichheit in von Menschen gewählten und konstruierten Systemen tief verwurzelt. In der Geschichte hat es Systeme gegeben, in denen – um einen biblischen Ausdruck zu zitieren – „Leiber und Seelen von Menschen“ als Waren gehandelt wurden, sowohl im buchstäblichen als auch im übertragenen Sinn. Die Frage ist, ob uns eine Rückkehr zu dem verkrachten Zirkus alter menschlicher Ideologien oder selbst eine neue und historisch informierte, weltumspannende Antwort auf die steigende Ungleichheit von dem Grundproblem menschlicher Habgier befreien wird.
Piketty betont, „dass dies keineswegs ein Klagebuch ist. Ich bin im Gegenteil von Haus aus optimistisch.“ Er sei aufrichtig bestrebt, den Rahmen für ein besseres System zu liefern, statt nur das aktuell vorherrschende und eindeutig unvollkommene System anzuschwärzen. Doch mit einer ideologischen Brille (ob von rechts oder von links aufgesetzt) oder einer Demokratie mit mehr Teilhabe bekomme man heute nicht einmal einen flüchtigen Blick auf die Lösung. Um diese Vision zu erfassen und anzufangen, sie zu verwirklichen, müsse jeder und jede von uns beginnen, ganz andere Entscheidungen zu treffen. Können wir das? Piketty räumt ein: „Die absolute Wahrheit darüber, wie gerechtes Eigentum, gerechte Grenzen, gerechte Demokratie, gerechte Steuern oder gerechte Bildung aussehen sollten, wird niemand je in Händen halten.“
Trotzdem führt ihn sein Optimismus zu dem Schluss, dass wir diesen Dingen näherkommen können. „Aber nur die sorgfältige Gegenüberstellung historischer und persönlicher Erfahrungen und möglichst umfassende Beratungen stellen Fortschritte in dieser Richtung in Aussicht.“ Eines dürfte freilich klar sein: Das Erste, das sich ändern müsse, sei der Hang der Menschen zu Habgier und Machtgier, der ihre Geschichte beklagenswerterweise geprägt habe – ganz gleich, welche Ideologie gerade vorherrschte. Erst, wenn wir beginnen, die Vorstellung zu hinterfragen, wir verdienten von Natur aus mehr als jemand anders, werde weltweite Gleichheit mit Fairness und Gerechtigkeit für alle eine Möglichkeit. Und dann hänge es wirklich davon ab, was wir wollen, denn Ungleichheit habe nicht nur mit Wohlstand zu tun: Sie habe damit zu tun, ob wir andere Menschen als gleichwertig anerkennen.



