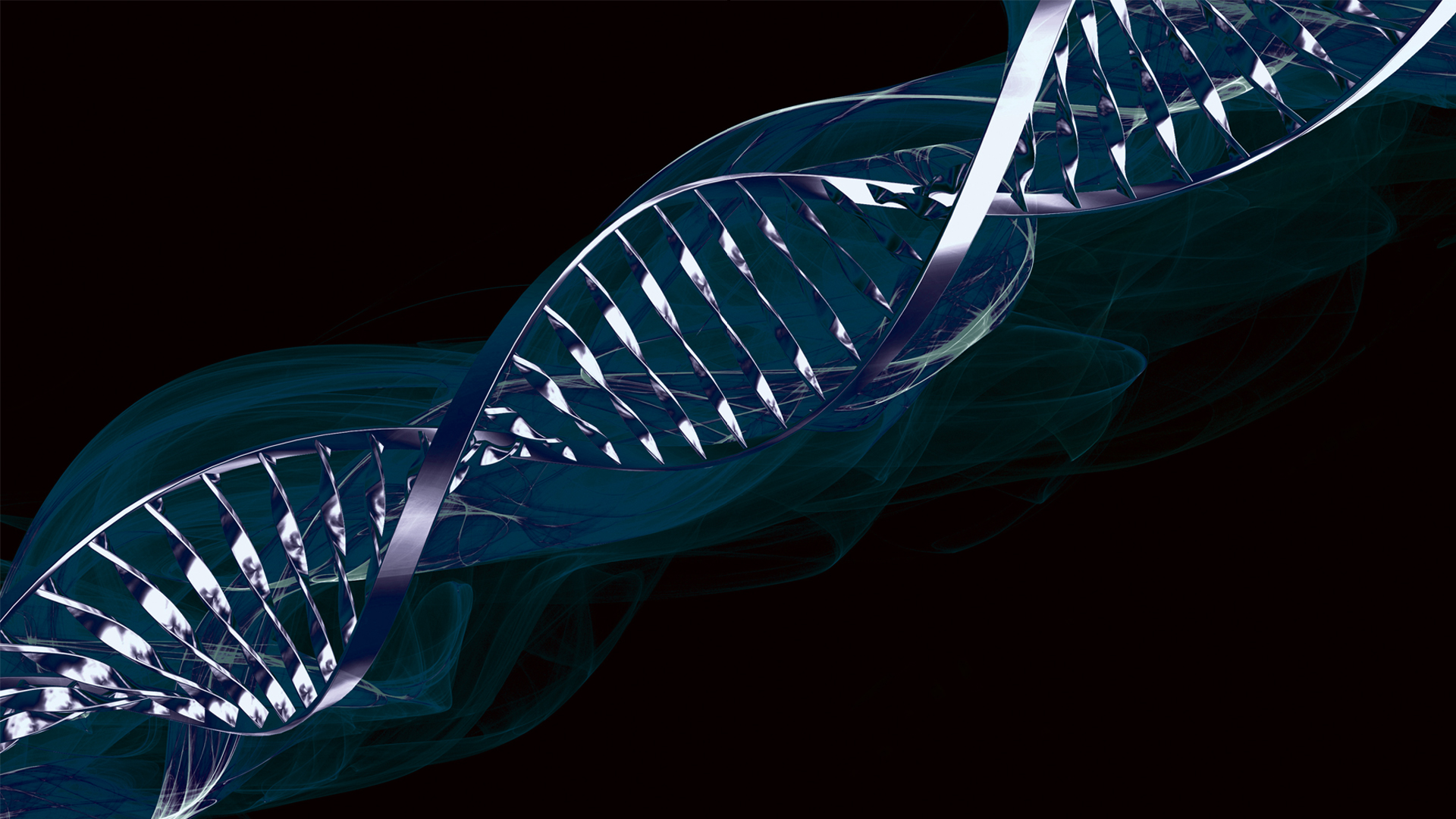Die Stürme des Lebens überstehen
Trauma – warum wir nicht alle gleich reagieren
Mit Stress geht jeder in seinem Leben um, aber nicht jeder geht auf die gleiche Weise mit ihm um. Und das kann Mitgefühl und Heilung wirklich erschweren. Was sollten wir über Trauma und Resilienz wissen?
Im Zeugenstand sagt eine Frau über einen sexuellen Übergriff aus, den sie vor Jahrzehnten erlitten hat. Niemand glaubt ihr, weil sie sich an bestimmte Details nicht erinnern kann und überhaupt nicht verstört wirkt. Sie bleibt unerschütterlich, was die Identität des angeblichen Angreifers betrifft, wirkt aber konfus, als sie nachdrücklich über die Logik ihres eigenen Handelns an jenem Abend befragt wird.
Die darauf folgenden Kommentare in sozialen Medien weisen auf diese scheinbaren Widersprüche hin; sogar einige, die ihrer Aussage glauben, bemerken: „Ich habe das Gleiche durchgemacht und musste deshalb kein großes Theater machen. Und warum erzählt sie ihre Geschichte so lange danach?“
Solche Dinge geschehen viel häufiger, als den meisten von uns bewusst ist, besonders wenn das Trauma mit sexueller Gewalt oder Misshandlung in der Kindheit zu tun hat. Wenn es einen Übergriff gab, würde das Opfer wirklich so lange damit warten, den Täter anzuklagen? Selbst wenn die Antwort ein Ja ist, warum leidet es noch immer, während andere sagen, sie hätten Ähnliches durchgemacht, ohne die gleichen Narben davonzutragen? Schaffen es manche Leute einfach besser, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen? Haben sie sich damit das Recht verdient, zu erwarten, alle anderen sollten „einfach das Gleiche tun“? Man muss Resilienz haben – psychische Widerstandsfähigkeit –, um sich von einem traumatischen Erlebnis zu erholen, aber man sollte auch ehrlich auf zwei Fragen antworten: „Woher ist diese Resilienz in meinem Fall gekommen?“ und „Hatte diese andere Person Zugang zu den gleichen Ressourcen wie ich?“
Einige dieser Ressourcen werden wir betrachten, doch erkennen wir zuvor eine unbewusste, aber verbreitete menschliche Voreingenommenheit an: die Vorstellung, unsere Welt sei in sich gerecht, manchmal als „Gerechte Welt-Glaube“ bezeichnet. Wer hart genug arbeitet, wird innerlich stark und wird deshalb Erfolg haben (das wären wir). Die Faulen und Laschen dagegen sind zu Armut und/oder psychischen Problemen verurteilt, da so das Leben nun mal funktioniert.
Es ist schwer, diese natürliche Voreingenommenheit zu überwinden. Ja, unter den richtigen Bedingungen lohnen sich harte Arbeit plus guter Charakter. Ja, es gibt faule Menschen, an deren Situation weitgehend ihr eigener fehlender Einsatz schuld ist. Aber es ist keine allgemeingültige Wahrheit, dass Leute, die sich anstrengen, immer Erfolg haben – und dass die, die keinen Erfolg haben, für ihre missliche Lage selbst verantwortlich sind.
Besonders gilt dies im Zusammenhang mit traumatischem Stress. Die Fähigkeit, sich von Stress oder einem Trauma zu erholen, wird als Resilienz bezeichnet, aber man erreicht sie nicht durch bloße Willenskraft. Es kann unendlich viele Gründe geben, warum ein Mensch ein höheres Maß an Resilienz hat als ein anderer.
Wie Resilienz entsteht
Im Folgenden werden fünf Bestimmungsfaktoren für die Grundausstattung eines Menschen mit Resilienz betrachtet. Ein Teil davon ist naturgegeben, ein anderer wird durch die Umwelt geformt.
1. Natur: ererbte Verdrahtung des Gehirns
Genetische Faktoren können das Risiko für Befindlichkeits- und Angststörungen (einschließlich der posttraumatischen Belastungsstörung) beeinflussen. Eine Veranlagung dafür kann in der DNS kodiert sein, aber eine lange Geschichte von Tierversuchen und nun eine wachsende Zahl von Studien mit Menschen lässt vermuten, dass sie auch durch epigenetische Kennzeichen von traumatisierten Eltern oder Großeltern vererbt werden kann. Insbesondere hat ein Trauma bei einer Schwangeren direkte Folgen für die Gehirnentwicklung ihres Kindes. Wie in jedem Forschungsgebiet gilt es hier, Schritt für Schritt vorzugehen, um genau herauszufinden, wie diese Prozesse funktionieren, aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten: Der epigenetische Effekt kann unter bestimmten Umständen ein Schutz sein.
„Neue Studien zeigen, dass Angst tatsächlich permanente epigenetische Spuren in Ihrer DNS hinterlassen könnte – Spuren, die Sie potenziell an Ihre Kinder oder Enkel weitergeben könnten.“
2. Umwelt: Umfeld und Bindungsqualität in der frühen Kindheit
Wir alle entwickeln emotionale Bindungen an wichtige Bezugspersonen; so funktioniert das menschliche Gehirn. Aber die Qualität solcher Bindungen ist aus mehreren Gründen unterschiedlich.
Die ersten Jahre im Leben eines Kindes sind besonders entscheidend für die Entwicklung emotionaler Regulierungssysteme. Diese werden physikalisch und chemisch durch die Qualität der Unterstützung programmiert, die die erwachsenen Bezugspersonen im Leben eines Kindes bieten. Wenn sie auf die Emotionen der Kinder eingehen und helfen, sie zu beruhigen, lernen Kinder, ihre Emotionen selbst zu beruhigen. Doch das ist kein bloßes Lernen. Der Prozess ist tatsächlich biologisch. Wenn ein Elternteil oder eine andere Bezugsperson auf ein Kind, das leidet, eingeht, gehen die Stresschemikalien im Gehirn und im Körper des Kindes zurück zu einem Zustand der Harmonie oder des „Einklangs“ mit der Person, die für das Kind sorgt – und das ist der optimale Zustand für die Ausprägung gesunder Stress-Schaltkreise.
Brüche dieser Harmonie wird es natürlich geben. Aber die Bemühungen der Bezugsperson, sie zu reparieren, führen dazu, dass ein Kind allmählich die Fähigkeit entwickelt, selbstständig zu einem Zustand des Gleichgewichts zurückzukehren. In dieser Phase kann die emotionale Verschaltung eines Kindes somit konditioniert werden, gegenüber Stress resilient zu sein, während ein gleichgültiges oder misshandelndes Umfeld ein Kind hoch anfällig für Befindlichkeits- und Angststörungen in seinem späteren Leben machen kann.
So wichtig die frühe Umgebung auch ist, können dennoch zwei Kinder aus demselben liebevollen, aufmerksamen Haushalt unterschiedlich viel Resilienz entwickeln, weil sie, wie schon erwähnt, unterschiedliche Veranlagungen geerbt haben
3. Umwelt: Soziales Umfeld und persönliche Unterstützer-Netzwerke
Selbst wer sich für introvertiert hält, braucht Menschen ebenso wie alle anderen. Ohnehin sind die meisten Menschen weder introvertiert noch extravertiert, sondern eher ambivertiert – etwas zwischen den beiden Extremen. Jedes menschliche Gehirn braucht gesundheitsfördernde Verbindungen mit der Familie, verschiedenen Gemeinschaften und der weiteren Umwelt. Der Glaube eines Menschen gehört zu seinem sozialen Umfeld; Psychologen bestätigen, dass religiöse Zugehörigkeit eine starke Kraftressource sein kann. (Allerdings können skrupellose Menschen Religion auch benutzen, um andere zu missbrauchen und zu kontrollieren.)
Natürlich hat man nicht immer den Luxus, sich sein soziales Umfeld aussuchen zu können. Die Familie, in die ein Mensch hineingeboren wird, ist in hohem Maße ausschlaggebend dafür, was seine anderen Gemeinschaften sein werden und wie verfügbar unterstützende Beziehungen sein könnten.
Doch das ist nicht der einzige Faktor. Auf eine merkwürdige Weise kommt auch die geerbte Verdrahtung ins Spiel. So haben manche Menschen vielleicht eine schwache Resilienz geerbt. Wenn sie zudem in den entscheidenden Entwicklungsphasen in der Kindheit traumatisiert worden sind und wenn die Interaktionen ihrer Betreuer mit ihnen extrem widersprüchlich waren, dann werden sie als Erwachsene wahrscheinlich große Schwierigkeiten haben, emotional mit anderen in Verbindung zu kommen. Sie werden soziale Signale missverstehen und anderen verwirrende Signale geben. Sie können zu der Überzeugung kommen, dass man sie nicht lieben kann – und in dieser Überzeugung werden sie durch die Reaktionen anderer Menschen auf ihr verwirrendes Verhalten ständig bestärkt.
Dieser Teufelskreis lässt sich durchaus brechen. Aber wegen der biologischen Natur des Problems ist Hilfe von unterstützenden Menschen erforderlich. Wenn man sich den „Stressapparat“ im Gehirn als etwas Ähnliches vorstellt wie den Muskelapparat, dann ist ein System der Unterstützung durch andere Menschen wie ein Spotter, der einem Gewichtheber Hilfestellung dabei gibt, mehr zu stemmen, als er allein kann, bis sein Körper sich so verändert hat, dass er es allein schafft.
4. Umwelt: Kulturelle Einstellungen und Netzwerke der breiteren Gesellschaft
Die Verfügbarkeit individueller, finanzieller oder von der Gesellschaft getragener Programme zur Unterstützung von Menschen, die psychologische Hilfe brauchen, hängt zum Teil von kulturellen Einstellungen ab. In Kulturen, in denen es als Zeichen von Schwäche gilt, Hilfe zu brauchen, sind von der Gesellschaft getragene Programme vielleicht keine Priorität. Selbst wenn es sie gibt, kann das soziale Stigma Hilfsbedürftige davon abhalten, um Hilfe zu bitten.
„Wir haben Heads Together ins Leben gerufen – das ist eine Kampagne, um dem Stigma um das Thema psychische Gesundheit beizukommen, denn wir dachten, wenn wir dem Stigma beikommen könnten, wäre das etwas, das diesen Hilfsorganisationen für psychische Gesundheit ermöglichen würde, mehr von ihrer Arbeit zu tun.“
Kulturelle Einstellungen können auch auf Familienmitglieder wirken und einen Einfluss darauf haben, ob sie auf das Bedürfnis eines traumatisierten Angehörigen nach emotionaler Unterstützung eingehen. Diese Einstellungen können entscheidend dafür sein, ob man signalisiert „Ich bin für dich da“ oder im Gegenteil „Warum kannst du nicht einfach so wie ich damit fertig werden?“.
5. Merkmale des Trauma-Erlebens
Die Reaktion eines Menschen auf ein Trauma kann ebenso von seiner angeborenen Ausstattung mit Resilienz bestimmt sein wie von der Anzahl oder Heftigkeit seiner Stresserlebnisse, doch bestimmte Arten von Trauma sind besonders schädlich. Lang anhaltender und kumulativer Stress kann bewirken, dass die für Stressreaktionen zuständigen Gehirnareale über lange Zeit in einem Alarmzustand bleiben – und das kann physischen Schaden anrichten. Jemand, der ein einziges traumatisches Ereignis erlebt, wird wahrscheinlich anders darüber hinwegkommen als jemand, der viele Episoden eines bestimmten Traumas erlebt hat oder bei dem sich im Laufe der Zeit Traumata verschiedener Art angehäuft haben.
Doch Forscher haben festgestellt, dass zwischen verschiedenen Arten traumatischer Erlebnisse selbst unter Berücksichtigung dieser Faktoren signifikante Unterschiede im Schweregrad der Symptome bestehen.
Ein Merkmal, das den Schweregrad erhöht, ist Verrat. Familiäre Dysfunktion, z. B. häusliche Gewalt oder Kindesmissbrauch, bewirkt in der Regel mehr seelische Not als Trauer oder Verlust. Und je enger die familiäre Beziehung, desto massiver ist die Wirkung. Eine auf Vertrauen beruhende Beziehung ist verraten worden und der oder die Überlebende hat nun den Konflikt zwischen dem naturgegebenen Bedürfnis nach Verbindung mit seinen Familienmitgliedern und dem Bedürfnis nach Selbstschutz.
Auch wie Trauma-Überlebende ihre Erfahrung bewerten, beeinflusst den Schweregrad ihrer Reaktionen. Wenn sie sich selbst die Schuld geben oder ihr eigenes Verhalten und Denken in negativem Licht sehen, haben sie wahrscheinlich stärkere Symptome von Depression und posttraumatischem Stress. Besonders Kinder neigen dazu, die Schuld für traumatischen Verrat bei sich selbst zu sehen, aber auch Erwachsene tun das – Männer wie Frauen. Oft werden sie darin von Mitgliedern der Familie und des sozialen Umfeldes bestärkt, die ebenfalls mit dem Finger auf sie zeigen.

Nicht vergleichen
Man könnte noch weitere Faktoren betrachten, doch diese fünf dürften uns nachdenklich machen, wenn wir versucht sind, uns mit anderen zu vergleichen. Wir alle wünschten, es gäbe einen Knopf, den Menschen, die unter Traumafolgen leiden, „einfach“ drücken könnten, damit sie nicht so viel Hilfe von uns brauchen. Es kann verlockend sein, zu denken: „Wenn die einfach positiv denken würden, müsste ich nicht auf sie zugehen. Ich fühle mich einfach nicht wohl mit denen. Ich komme über Schwierigkeiten in meinem Leben weg; warum kommen die über ihre nicht weg?“
Ja, es kann harte Arbeit sein, Liebe und selbstlose Fürsorge zu üben, aber wir dürfen uns selbst nicht als irgendwie überlegen sehen; wir hatten vielleicht Zugang zu Ressourcen, die jemand anderes nicht hatte. Jeder von uns ist wahrscheinlich einzigartig, wenn es um Resilienz geht, da jeder von uns das Ergebnis einer eigenen Kombination aus Natur, Umwelt und Epigenetik ist. Wenn wir zufällig zu den Starken gehören, kann es ein enormes Privileg sein, als „Spotter“ für andere zu dienen, die vielleicht zu kämpfen haben, um ihre Last zu heben und ihre Resilienz-„Muskeln“ aufzubauen. Wenn wir aber nicht anerkennen, dass wir unsere eigene Resilienz nicht allein aufgebaut haben, kann uns die lehrreiche und erfüllende Erfahrung entgehen, jemand anderem zu helfen.
Es ist nützlich, zuerst zu verstehen, wie ein Trauma im Gehirn und im Körper wirkt und dadurch Gedächtnis und Verhalten beeinflusst. Dafür muss man das Gehirn als Bestandteil des Körpers verstehen. Die Diskussion darüber, ob psychische Probleme Entzündungen bewirken oder umgekehrt, ist sinnlos, weil psychische und körperliche Gesundheit zusammengehören. Man kann ein psychisches Problem nicht bewältigen, wenn man nur das Gehirn oder nur den Körper anspricht. So, wie es zu Entzündungen führen kann, wenn man sich nicht um seinen Körper kümmert (z. B. hinsichtlich Ernährung, Schlaf und Bewegung), kann auch psychischer und emotionaler Stress das zur Folge haben, wenn er eine negative hormonelle Reaktion auslöst. Neue Forschungsergebnisse der Epigenetik lassen darüber hinaus vermuten, dass psychische und emotionale Traumata Gehirnareale stören können, die bei der Verhinderung von Entzündungen eine Rolle spielen.
Wenn man versteht, dass wir nicht zwei separate Steuerzentren haben – dass sowohl das Gehirn als auch der Körper von unserem physischen und emotionalen Umfeld tief beeinflusst werden –, wird es viel leichter, zu verstehen, warum Menschen sehr unterschiedlich auf ein Trauma reagieren können.
Bei gewöhnlichem Stress bewertet das Gehirn die potenzielle Gefahr und setzt durch neurale und endokrine Schaltkreise eine „Gruppenkonferenz“ mit dem Herz-Kreislauf-System, dem Immunsystem und anderen Systemen des Körpers in Gang. Dann reagieren das Autonome Nervensystem (ANS) und die HPA-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse) mit der Anweisung „angreifen, fliehen oder erstarren“. Dies ist kurzfristig sehr nützlich. Die Botschaften des Gehirns lösen die Ausschüttung bestimmter Hormone aus und diese stellen alle physiologischen und kognitiven Systeme, die für den Moment nicht wirklich notwendig sind, auf „Warten“, damit die relevanteren Systeme auf Hochtouren kommen können. Wenn die Herausforderung vorbei ist, kehren alle Systeme in den Normalzustand zurück. Oft empfindet man ein anhaltendes Erfolgsgefühl, das den Glauben stärkt, ähnliche Herausforderungen auch künftig meistern zu können. Doch dazu gehört die Ausgewogenheit der beiden Nervensysteme Sympathicus und Parasympathicus. Ein ausgewogenes Nervensystem passt sich einem einmaligen Trauma an und erholt sich.
Sind Stress oder Trauma jedoch chronisch, passt sich das Nervensystem nicht an. Wenn die Stressreaktion des Körpers zu lange auf der Alarmstufe bleibt, bleiben die Systeme, die deaktiviert wurden, um eine vorübergehenden Lage zu unterstützen, länger deaktiviert, als es gesund ist. Je nachdem, in welcher Entwicklungsphase das Gehirn ist, kann das zu einer Vielzahl körperlicher und psychischer Probleme und einem lebenslangen Muster von Problemen mit der emotionalen Selbstregulierung führen. Chronischer Stress in der Kindheit untergräbt die Fähigkeit des Gehirns, emotionale Reaktionen richtig zu verarbeiten, und kann dadurch tiefgreifende Folgen für die spätere Resilienz eines Menschen haben.
„In der Kindheit chronischen, unberechenbaren, toxischen Stress zu erleben, prädisponiert uns für eine Konstellation chronischer Störungen im Erwachsenenalter.“
Das traumatisierte Gehirn
Erinnern Sie sich an die Frau in dem einleitenden Beispiel? Warum die Brüche in ihrer Erinnerung von dem Ereignis?
Während eines traumatischen Ereignisses setzt der Körper Hormone frei, darunter Cortisol und Adrenalin. Beide wirken direkt auf das Gedächtnis ein, aber in sehr unterschiedlicher Weise: Adrenalin verstärkt die Funktion der Amygdala – eines Gehirnareals, das auch Mandelkern genannt wird und eine zentrale Rolle bei der Speicherung von emotionalen Erinnerungen spielt; Cortisol dagegen hemmt die Funktion des Hippocampus, sodass die Fähigkeit des Gehirns abnimmt, Erinnerungen zu organisieren und zu konsolidieren. Auch Endorphine werden freigesetzt; sie wirken wie Opiate, um körperlichen und seelischen Schmerz zu dämpfen, während Katecholamine wie Adrenalin und andere Stresshormone das rationale Denken stören.
Ergebnisse dieses Hormonschwalls können lange nach dem traumatischen Ereignis physisch im Gehirn eingeprägt bleiben. Dies wirkt sich besonders auf drei wichtige Netzwerke im Gehirn aus: das Ruhezustandsnetzwerk (das bei der Verarbeitung von Erinnerungen, Gedanken an die Zukunft, Gemütszuständen etc. hilft), das Salienz-Netzwerk (zuständig für das, was in der Umgebung am meisten Aufmerksamkeit verlangt) und das Exekutivnetzwerk (zuständig für Planung, Denken, Konzentration und das Lösen von Problemen).
Nach einer reichlichen Portion dieser Hormonsuppe können Trauma-Opfer nach außen Signale zeigen, die für Beobachter mit vorgefassten Meinungen über Trauma verwirrend sein können. Dank der dämpfenden Wirkung der Endorphine wirken solche Opfer möglicherweise nicht verstört. Sie können Schwierigkeiten haben, sich an Ereignisse zu erinnern und sie geordnet wiederzugeben. Einiges von dem, was sie erzählen, kann unlogisch wirken, was den Katecholaminen geschuldet ist. Wenn eine Angststarre eingesetzt hat und sie sich nicht mehr bewegen konnten (eine verbreitete und oft unkontrollierbare Reaktion), könnte ein Beobachter den falschen Eindruck bekommen, die überlebende Person sei bei dem Ereignis passiv gewesen oder habe sogar eingewilligt. Ferner kann ein Trauma-Opfer bei den weniger wichtigen Details eines Ereignisses Verwirrung zeigen, obgleich wichtige Fakten wie die Identität zentral Beteiligter gut eingeprägt sind.
Dies ist in Jahrzehnten der Forschung und Untersuchung von Trauma-Opfern aller Art immer wieder bestätigt worden. Doch kennen Polizeibeamte diese verbreiteten Trauma-Reaktionen oft ebenso wenig wie alle anderen. Infolgedessen werden Männer oder Frauen, die z. B. sexuelle Gewalt erlitten haben – und die sich trauen, das zu melden – oft retraumatisiert, wenn sie von den Strafverfolgungsbehörden in die Mangel genommen und Kreuzverhören unterworfen werden oder wenn ihre Geschichten Futter für die Medien werden. Dies schreckt andere Gewaltopfer ab und macht es weit unwahrscheinlicher, dass sie ihre eigene Erfahrung in naher Zukunft melden. Und natürlich gilt: Je länger man etwas geheimhält, desto schwerer kann es sein, darüber zu reden.
Die Folge ist, dass die charakteristischen Reaktionen von Trauma-Überlebenden häufig genau der Grund sind, aus dem man ihnen nicht glaubt. Die Reaktionen des Gehirns auf traumatische Ereignisse folgen zwar vorhersehbaren Mustern, aber Unterschiede in der Resilienz können dies verdecken. Deshalb können zwei Menschen, die das gleiche Trauma erleben, in völlig unterschiedlichem Maß fähig sein, damit zurechtzukommen.
Glücklicherweise können Trauma-Opfer ihr Gehirn neu verschalten, um mehr Resilienz zu entwickeln. Damit dies geschieht, muss jeder von uns ganz bewusst sein Gehirn neu verschalten, um mehr Mitgefühl zu entwickeln. Zu verstehen, was Trauma bei Menschen bewirken kann, bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher.