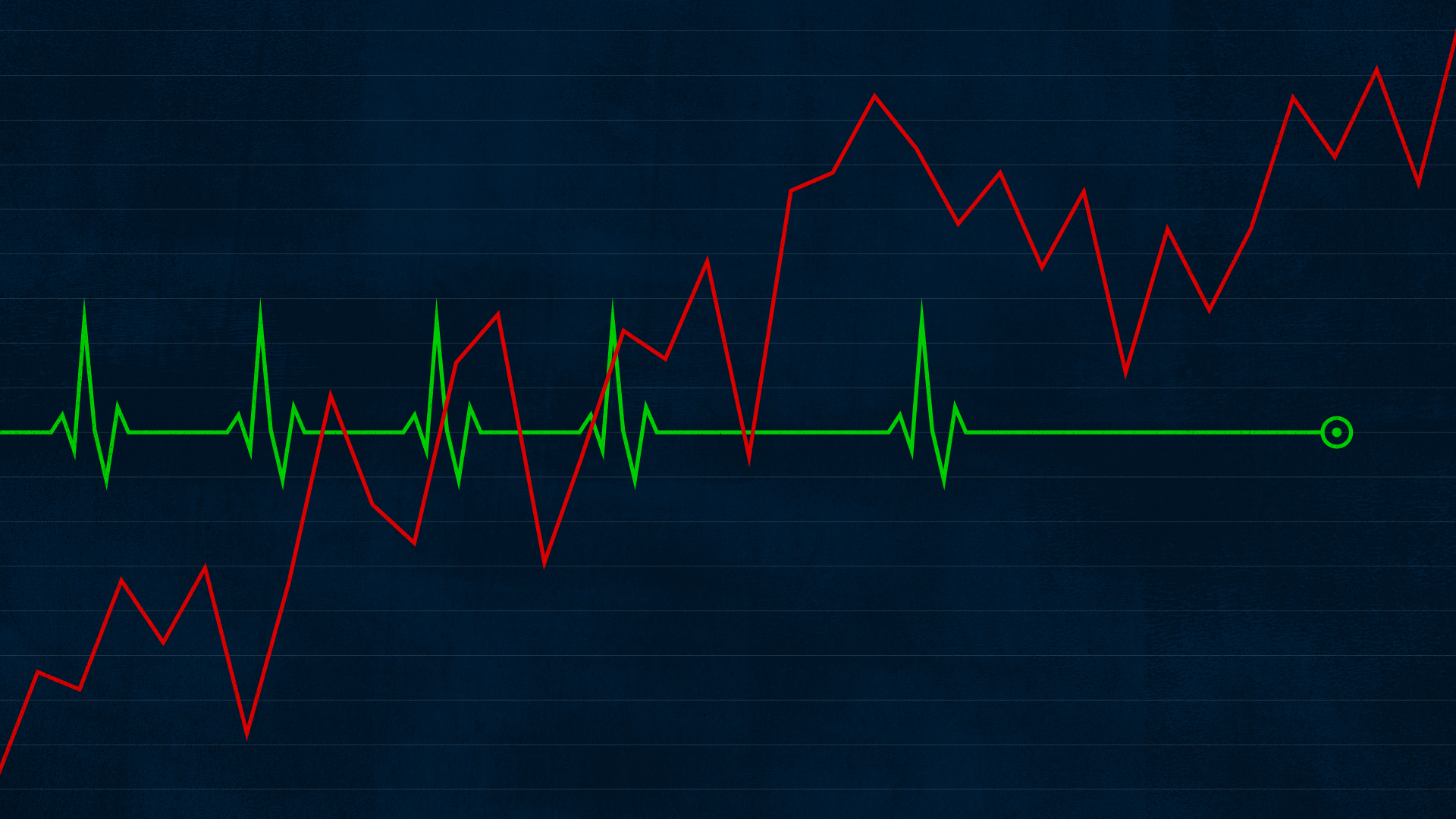Kann der Kapitalismus Rücksicht auf Menschen nehmen?
„Es gibt eine und nur eine gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen“, schrieb der Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman 1962: „ihre Ressourcen so einzusetzen und ihre Aktivitäten so auszurichten, dass sie ihre Gewinne steigern, solange sie sich an die Spielregeln halten.“
Der US-Konzern Smithfield Foods, der auch in Mexiko und Europa aktiv ist, hat eine Fabrik zur Schweinefleischverarbeitung in Sioux Falls, South Dakota – die neuntgrößte dieser Art in den USA mit rund 3700 Angestellten. Bei voller Auslastung werden dort täglich fast 20000 Schweine zu einer Vielfalt von Nahrungsmittelprodukten verarbeitet – vergleichbar mit den Tönnies-Werken in Deutschland.
Am Anfang der Coronapandemie mussten viele Unternehmen vorübergehend schließen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, doch Smithfield blieb offen; als Nahrungsmittellieferant galt es als systemrelevant. Aber die Fabrik in Sioux Falls hatte ein Problem.
Am 26. März 2020, bei rasant steigenden Infektionszahlen an der Ostküste der USA, berichtete die lokale Zeitung Argus Leader, dass es bei Smithfield einen bestätigten Coronafall gab. Die Chefetage entschied, die Fabrik trotzdem weiterhin geöffnet zu lassen, und bot den Angestellten einen Bonus an. Doch am 9. April berichtete die Zeitung: „Die Arbeiter sagen, sie fühlen sich nicht sicher und sie finden nicht, dass ein ,Verantwortungsbonus‘ von 500 Dollar […] eine ausreichende Vergütung dafür ist, ihre Gesundheit oder potenziell ihr Leben aufs Spiel zu setzen.“ Viele Mitarbeiter, insbesondere die, die fast Schulter an Schulter am Fließband arbeiteten, gehörten den untersten sozioökonomischen Schichten an und hatten wenig finanzielle Sicherheit. Verständlicherweise fühlten sie sich zu einer folgenschweren Entscheidung gezwungen: entweder ihre Gesundheit oder ihre Arbeit.
Am 2. April gab es 19 bestätigte Fälle unter ihnen, und nun führte Smithfield ein robusteres Testprotokoll ein. Doch am 11. April waren aus Smithfields einzigem Fall 369 geworden, wie das CDC (Zentrum für Krankheitskontrolle) berichtete. Während dieser gesamten Zeit blieb die Fabrik in Betrieb, doch ab dem 12. April wurde die Produktion gedrosselt und dann ganz eingestellt, während das Gesundheitsministerium von South Dakota und das CDC ermittelten. Vom 16. März bis zum 25. April bestätigten Laborbefunde 929 Coronafälle unter den Angestellten der Fabrik (25,6 % der Belegschaft) und weitere 210 bei deren direkten Kontaktpersonen.
Smithfields Widerstreben, sofort und wirksam zu handeln, hatte Parallelen in vielen Regionen der Erde. Gründe dafür waren unter anderem Trägheit und ein allgemeiner Mangel an klaren, verfügbaren Informationen, aber es gab auch gewichtige wirtschaftliche Beweggründe. Ein entscheidendes Glied wie Smithfield aus der Produktionskette für Nahrungsmittel zu entfernen, hat Folgen für viele andere – von den Herstellern von Futtermitteln für Schweine bis zu den Verbrauchern, die Schweinefleisch kaufen, um es zu Hause auf ihren Tisch zu bringen. In Betrieb zu bleiben und alle Beteiligten zu schützen, wäre zwar möglich gewesen, aber auch teuer. Wie es scheint, war die Priorität von Smithfields Leitung der Gewinn. Ihr Dilemma lag an der Schnittstelle zweier konkurrierender Impulse: Geld verdienen gegen Rücksicht auf andere nehmen.
Dies ist ein Konflikt, der Unternehmen in jeder Branche und in jedem Land betrifft. Die entscheidenden Fragen sind leicht zu formulieren, aber schwer zu beantworten: Wer oder was sollte einem Unternehmen am wichtigsten sein? Seine Kunden, seine Mitarbeiter oder seine Anteilseigner (das bedeutet seine Gewinnspanne)? Sollte ein Unternehmen ethisch verantwortungsvoll handeln? Sollte es bei Entscheidungen die Gesundheit der Mitarbeiter und der Gesellschaft berücksichtigen? Was sollte im Fall einer Katastrophe wie der Coronapandemie die oberste Priorität sein?
Das ist ein Zwiespalt im Kern des kapitalistischen Systems, der uns alle betrifft, in welchem Winkel der Welt wir auch sind. Und es gibt keine einfachen Antworten.
Die Lehre von der freien Marktwirtschaft
Um Unternehmensverantwortung ging es dem Business Roundtable (einer Non-Profit-Organisation von US-Konzernchefs), als er im August 2019 eine Aktualisierung seiner Principles of Corporate Governance herausgab. Der neue Standpunkt der Mitglieder war das Gegenteil dessen, was sie seit 1997 vertreten hatten: Es solle nicht mehr das primäre Ziel eines Unternehmens sein, den Gewinn für die Anteilseigner zu maximieren, sondern es solle auch anderen „Stakeholdern“ (Personen mit berechtigten Interessen) Nutzen bringen – Mitarbeitern, Kunden und Bürgern.
Dies ist ein frappierender und dramatischer Umschwung. Die Ansicht, dass Unternehmen sich auf mehr als nur Gewinnspannen konzentrieren sollten, bricht mit Jahrzehnten dogmatisch kapitalistischer Lehre von der freien Marktwirtschaft. Nüchtern betrachtet, dürfte es unwahrscheinlich sein, dass irgendjemand wegen dieser öffentlichen Stellungnahme tatsächlich sein Verhalten ändert. Die Tatsache, dass dies überhaupt geäußert wurde, ist allerdings bemerkenswert. Es lohnt sich, zu fragen, was das für eine freie Marktwirtschaft bedeuten würde, die heute wirklich eine globale ist.
„Die Erklärung ist zwar eine willkommene Zurückweisung einer höchst einflussreichen, aber falschen Theorie der Unternehmensverantwortung, […] doch der einzige Weg, Unternehmen zu zwingen, im öffentlichen Interesse zu handeln, ist, sie gesetzlichen Regelungen zu unterwerfen.“
Die klassische Lehre der freien Marktwirtschaft besagt, dass sich ein Unternehmen ausschließlich darum zu kümmern hat, Geld für seine Anteilseigner zu verdienen. Eine Firma, so die Theorie, muss all ihre Ressourcen für die Gewinnmaximierung einsetzen. Etwas anderes zu tun, schrieb der US-Nationalökonom Milton Friedman 1962, würde „die Grundfesten unserer freien Gesellschaft selbst vollkommen untergraben“. Dementsprechend werden Arbeitsplätze und Löhne auf ein Minimum reduziert, die Arbeitszeit wird verlängert, und Mitarbeiter werden nach ihrer Kostenproduktivität angeheuert und entlassen. Es bedeutet auch, dass andere Faktoren wie Umweltauswirkungen und ethische Belange, die Transparenz der Aussagen von Unternehmen und die Gesundheit der Mitarbeiter (wie im Fall Smithfield) nachrangig sind.
Die Kernprinzipien des Kapitalismus gibt es schon lange, wenn auch in unterschiedlichen Formen. Menschen haben fast immer nach Besitz gestrebt. Doch die freie Marktwirtschaft, die wir heute haben, ist noch relativ jung. Im 18. Jahrhundert beschrieb der politische Philosoph Adam Smith aus Schottland dieses System und äußerte die bahnbrechende Behauptung, Eigennutz sei für uns alle von Vorteil. „Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers oder Bäckers erwarten wir unsere Mahlzeiten, sondern von deren Bedachtnahme auf ihr eigenes Interesse“, schrieb er in The Wealth of Nations. „Wir wenden uns nicht an ihre Menschenliebe, sondern an ihre Eigenliebe, und sprechen zu ihnen nie von unseren eigenen Bedürfnissen, sondern von ihren Vorteilen.“ Der Bäcker will Geld verdienen, deshalb stellt er Brot her (das wir haben wollen), um es zu verkaufen; wir wiederum produzieren aus unserem Eigennutz Waren oder Dienstleistungen, um sie zu verkaufen.
Der freie Marktkapitalismus, der auf diesem Prinzip aufbaut, ist ein System des Nehmens. Wir würden die Bedürfnisse anderer nicht erfüllen, wenn wir nicht selbst einen Nutzen davon hätten.

Freiheit zur Bewegung
Der Kapitalismus hat ein weiteres beachtenswertes Merkmal: Ein freier Markt erfordert Bewegung. Die Wirtschaft muss ständig in Bewegung sein. Wir müssen kaufen und verkaufen, wir müssen Wohlstand schaffen und anhäufen und dann wieder einsetzen, und wir dürfen nicht damit aufhören. Metzger, Brauer und Bäcker müssen täglich produzieren und verkaufen, um zu überleben. Stillstand bedeutet Tod. Waren, Dienstleistungen und Arbeit brauchen „Bewegung, Bewegung, Bewegung“ (wie Henry James in seiner denkwürdigen Beschreibung New Yorks im frühen 20. Jahrhundert schrieb), damit alle profitieren. Am spürbarsten ist die Bedeutung von Bewegung, wenn es eine Zwangspause gibt, wie beispielsweise in einer Rezession oder Pandemie. In einer solchen Situation reagiert der Markt zuerst oft mit Panik.
Friedman betrachtete dies von der anderen Seite – statt über einen Zwang zur Bewegung schrieb er über Freiheit zur Bewegung als etwas höchst Wünschenswertes. Er fand, der Kapitalismus passe perfekt zum Begriff der Freiheit, die er mit dem Liberalismus der Zeit vor dem 20. Jahrhundert gleichsetzte. Aus dieser damaligen liberalen Perspektive schrieb er, das ideale Ziel des Marktes sei, „für jeden Einzelnen das höchste Maß an Freiheit zu bewahren, das damit vereinbar ist, dass die Freiheit des einen nicht die Freiheit des anderen einschränkt.“
Für Friedman war Freiheit ein so hohes Gut, dass jedwede Einschränkung – durch Regierungen, Unternehmen oder sonstige Autoritäten – absolut unerwünscht war, sobald sie über ein notwendiges, bloßes Minimum hinausging. Am meisten zuwider war ihm jede Art von Einschränkung des Verkehrs von Waren, Dienstleistungen oder Arbeitskräften in der Wirtschaft.
„Was uns die Verfechter des freien Marktes – oder wie sie oft genannt werden: die Neoliberalen – erzählt haben, war bestenfalls nur zum Teil wahr und schlechtestenfalls schlicht falsch. […] Die ,Wahrheiten‘, die uns die Ideologen des freien Marktes verkaufen wollen, beruhen auf faulen Annahmen und Scheuklappenvisionen.“
Der Reiz von Freiheit und ungehinderter Bewegung ist unleugbar, und diese Form des Kapitalismus ist für viele führende Köpfe der letzten Jahrzehnte eine zentrale Philosophie gewesen. US-Präsident Ronald Reagan sagte ehrfürchtig: „Der Markt hat wirklich etwas Magisches, wenn er frei funktionieren kann.“ Für manche ist das die einzig mögliche Art, zu leben. Der Autor und Journalist Thomas Friedman schrieb 1999: „Der freie Markt ist die einzige ideologische Alternative, die noch geblieben ist.“ Des Weiteren stellte Milton Friedman die Abwesenheit von Beschränkungen als nicht nur ein wirtschaftliches Protokoll, sondern als eine Lebensphilosophie dar, und erklärte: „Freiheit ist eine seltene und zarte Pflanze.“ 1990, vielleicht auf dem Höhepunkt der Liberalismus-Hybris des Westens, sang die Rockband Primal Scream: „We wanna be free to do what we wanna do“ (wir wollen frei sein, zu machen, worauf wir Bock haben).
Es klingt alles so wunderbar, und der schlichte Charme des Kapitalismus ist ungemein populär. Doch was sich in den letzten Jahren gezeigt hat, ist ein Sumpf aus unwillkommenen Konsequenzen, die wir tunlichst beachten sollten.
Ironie und Dilemma
Jahrzehnte des freien Marktkapitalismus haben enormen (allerdings ungleich verteilten) Wohlstand geschaffen, aber im Bereich der Menschlichkeit eher magere Resultate gebracht. In seiner krassesten Form ist der Kapitalismus ein Dienstherr, der brutal und obendrein zynisch ist. Er begünstigt Altruismus nicht und sieht Menschen als Funktionen, die zu nutzen und zu bewegen sind, wie es der Markt verlangt.
Die russisch-amerikanische Autorin und Theoretikerin Ayn Rand hat es vielleicht am plakativsten formuliert: „Kein Schaffender [kein Denker, Künstler, Wissenschaftler, Erfinder] war von dem Wunsch motiviert, seinen Brüdern zu dienen. […] Der Schaffende diente nichts und niemandem. Er hatte für sich selbst gelebt.“
Mit bissigen Worten brachte der Wirtschaftswissenschaftler Ha-Joon Chang die inhärente Ironie in diesem Modell zum Ausdruck: „Der Markt spannt wunderschön die Energie selbstsüchtiger Individuen ein, die nur an sich selbst (und höchstens noch an ihre Familie) denken, um soziale Harmonie herzustellen.“ Zwar sprach er sich gegen die Abgebrühtheit einer solchen Sichtweise aus, doch wäre ihre Anwendung in einem südasiatischen Ausbeuterbetrieb, einem multinationalen Lieferservice oder irgendeinem Unternehmen, das Personal mit Nullstundenverträgen beschäftigt, nicht fremd. Der Kapitalismus ist nicht blind für Eigenschaften wie Ehrlichkeit und Integrität – er sieht sie lediglich als essenziell egoistische Funktionen, deren Nutzen in erster Linie die Gewinnmaximierung ist.
„Es gibt eine und nur eine gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen: ihre Ressourcen so einzusetzen und ihre Aktivitäten so auszurichten, dass sie ihre Gewinne steigern, solange sie sich an die Spielregeln halten.“
Auf der positiveren Seite behauptet die Theorie auch, der Markt mäßige die Exzesse der Menschheit. Ein Unternehmen könnte zum Beispiel den Preis für ein Produkt nicht zu hoch ansetzen, weil ein Konkurrent ihn unterbieten würde; Arbeitnehmer könnten nicht faul werden, weil sie wüssten, dass sie leicht zu ersetzen wären. Das mag wahr sein, doch fragt man sich, ob eine Welt von ausgebremstem Eigennutz ein sonderlich wünschenswertes Ergebnis ist.
Der deutsche Soziologe und Politologe Max Weber schrieb zu Beginn des 20. Jahrhunderts über das Potenzial, dass „der Geist des Kapitalismus“ auf utilitaristisches Denken reduziert wird: „Die Ehrlichkeit ist nützlich, weil sie Kredit bringt, die Pünktlichkeit, der Fleiß, die Mäßigkeit ebenso, und deshalb sind sie Tugenden: – woraus u. a. folgen würde, daß, wo z. B. der Schein der Ehrlichkeit den gleichen Dienst tut, dieser genügen und ein unnötiges Surplus an dieser Tugend als unproduktive Verschwendung […] verwerflich erscheinen müßte.“ Bei dieser Sichtweise sind moralische Tugenden bloßes Rohmaterial für Profit.
Es ist eine zynische Sichtweise, und wie Weber anerkannte, leiden Menschen oft unter ihr. Es ist leicht zu erkennen, dass dann ein erkrankter Arbeitnehmer – wie im Fall des ersten Coronapatienten von Smithfield oder eines Profisportlers mit Gehirnerschütterung – als ein unproduktives Glied in der Kette gesehen werden kann, das Verlust bedeutet und ersetzt werden muss.
In Smithfields Fall war das Dilemma ebenso vertrackt wie real. Wenn ein kranker Arbeitnehmer zu Hause bleibt, mag die Profitabilität des Unternehmens sinken. Die Aussicht auf eine komplette Schließung der Fabrik vergrößert diesen finanziellen Verlust enorm. Hinzu kommt, dass Smithfield als einer der größten Arbeitgeber in der Region wichtig für deren gesamtwirtschaftliche und soziale Gesundheit ist. Zudem kann die Schließung einer Produktionsstätte die Lebensfähigkeit von anderen gefährden, die ihr in der Lieferkette vor- oder nachgelagert sind.
Sollte es einem Unternehmen rein um den Gewinn gehen? In welchem Maß sollte es die Auswirkungen berücksichtigen, die seine Entscheidungen auf so viele andere haben, nicht zuletzt seine Angestellten? Arbeitnehmer sind ebenso Menschen wie, wirtschaftlich gesehen, Mechanismen, die Gewinn erzeugen (in diesem Fall in Form von Koteletts, Spiralschinken und ähnlichen Produkten). Ihre Fähigkeiten als Menschen, zu arbeiten, zu produzieren, zu innovieren, sind hieran gebunden, aber auch ihre Sicherheit, ihre psychische Gesundheit, ihr Selbstwertgefühl und so weiter.
Gerade die letzteren Eigenschaften, die nicht sofort erkennbar Gewinn bringen, werden von Unternehmen nun allmählich und mit Verspätung wahrgenommen.
Zwang zur Arbeit
In der Praxis gibt es natürlich in aller Welt viele weniger harte und zynische Sichtweisen. Kapitalismus ist in China anders als in den USA und dort wiederum anders als in Schweden. Doch wenn es hart auf hart kommt, werden die Prioritäten des Systems rasch offensichtlich. Wenn wir in Eigennutz geschult werden, wenn wir, wie Weber schreibt, „gezwungen“ sind, auf diese Weise zu leben, setzt ein auf das Ich fokussierter Überlebensinstinkt ein; man will seinen Arbeitsplatz behalten, essen, sich sicher fühlen. Im kapitalistischen System bedeutet dies „das Wichtigste zuerst“; und aus der Sicht der Unternehmen ist „das Wichtigste“ von jeher der Gewinn. Infolgedessen werden Belange wie Fürsorge für Arbeitnehmer, Spenden für gute Zwecke, schonender Umgang mit der Umwelt, öffentliche Bildung und selbst das Überleben kleinerer Konkurrenten zur Nebensache, scheinbar weniger wichtig.
Es lohnt sich, zu fragen, ob wir unsere Welt einem System gewidmet haben, das der gegenseitigen Fürsorge von Grund auf entgegensteht.
Das Desinteresse des Kapitalismus an der Gesundheit von Arbeitnehmern geht über das körperliche Wohl hinaus; seine Fixierung auf Gewinn hat auch schwerwiegende Folgen für deren psychisches Wohl. Unser Arbeitsleben ist untrennbar mit einem hohen Maß an Sorge und Stress verbunden. So viele von uns sprechen heute davon, wie viel wir zu tun haben, obgleich wir jeden Tag zeitsparende Geräte wie Mobiltelefone, Waschmaschinen und digitale Drucker nutzen. Es ist paradox, aber möglicherweise steckt dahinter der Zwang des kapitalistischen Systems, in Bewegung zu sein.
Der deutsche Philosoph Walter Benjamin sah den Kapitalismus als Religion: „Es gibt da keinen ,Wochentag‘, keinen Tag der nicht Festtag in dem fürchterlichen Sinne der Entfaltung allen sakralen Pompes, der äußersten Anspannung des Verehrenden wäre.“ Es gibt keine Ruhe, keine Pause. Zeit ist Geld; jeder Moment ist einer, der dem weiteren Erwerb und Gewinn gewidmet werden könnte und tatsächlich sollte. Der Kapitalismus sei „vermutlich der erste Fall eines nicht entsühnenden, sondern verschuldenden Kultus“, so Benjamin weiter, „ein ungeheures Schuldbewußtsein, das sich nicht zu entsühnen weiß“. Dieses Schuldbewusstsein findet seinen Widerhall in der Sorge, die heute so allgegenwärtig scheint.
Auch Weber staunte über das unablässige Habenwollen des Kapitalismus und darüber, dass er Menschen antreibt, sich mehr aneignen zu wollen, als sie eigentlich zum Leben brauchen.
„Vor allem ist das ,summum bonum‘ dieser ,Ethik‘: der Erwerb von Geld und immer mehr Geld […] so rein als Selbstzweck gedacht, daß es als etwas gegenüber dem ,Glück‘ oder dem ,Nutzen‘ des einzelnen Individuums jedenfalls gänzlich Transzendentes und schlechthin Irrationales erscheint.“
Dieser Zwang ist überall in der kapitalistischen Gesellschaft zu sehen, von der Kultur der langen Arbeitszeiten bis zu der unablässigen Investitionstätigkeit der Superreichen. Das bedeutet nicht, dass der Kapitalismus unseren Wunsch nach immer mehr geschaffen hat, sondern, dass er ihn fördert – mit unerwünschten Nebenwirkungen für unsere Lebensqualität. Könnte es sein, dass der Kapitalismus Anti-Glück und Anti-Freude ist?
Trotz gegenteiliger Versprechungen ist zum Beispiel der Arbeitslohn in den USA heute inflationsbereinigt nicht höher als 1970. Manche wenden ein, dass Leistungen für Arbeitnehmer wie vom Arbeitgeber bezahlte Krankenversicherung zugenommen haben und dass damit der Reallohn gestiegen sei. Dass viele Arbeitgeber den Löwenanteil der Krankenversicherung für die Familie bezahlen – derzeit durchschnittlich über 21000 Dollar pro Jahr und Arbeitnehmer –, verhilft diesem allerdings nicht zu mehr Kaufkraft im Alltag. Das hat mit dazu geführt, dass in vielen Haushalten mehr als eine Person berufstätig ist.
Dem Kapitalismus zufolge ist das großartig: Wenn jeder Haushalt zwei Berufstätige hat und dann jemand anderen beschäftigen muss (beispielsweise für die Kinderbetreuung oder als Haushaltshilfe), dann sinken die Arbeitslosenzahlen, und die Produktivität und der Markt wachsen. Aber das tatsächliche Bild ist weit trüber, und die Folgen wie die Verknappung der Freizeit, der Kindererziehung sowie der Pflege der Ehe und anderer Beziehungen werden vielleicht noch nicht in vollem Umfang gewürdigt.
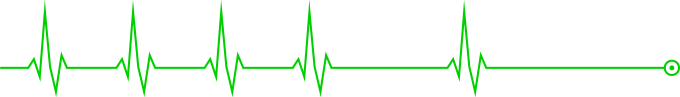
Chancenungleichheit
Die freie Marktwirtschaft hat auch Auswirkungen auf das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, denn das System bindet beides direkt an Bezahlung und Produktivität. Die enormen Gehälter der obersten Firmenchefs sind laut der Theorie der freien Marktwirtschaft gerechtfertigt, weil diese so viel Mehrwert für das Unternehmen produzieren. Chang schrieb dazu: „Wenn die Chefs 300-mal mehr bekommen als der durchschnittliche Arbeitnehmer, sagen sie, müsse das sein, weil sie 300-mal mehr zusätzlichen Wert für das Unternehmen bringen.“ Tatsächlich entspricht das ziemlich genau Milton Friedmans Sicht. Zu den international so unterschiedlichen Lebensbedingungen meinte er: „Wenn der japanische Arbeitnehmer einen niedrigeren Lebensstandard hat als der amerikanische, dann ist das so, weil er im Durchschnitt weniger produktiv ist als der amerikanische.“
Der Pferdefuß hier ist „im Durchschnitt“ – ein ohnehin unklarer Begriff, der nur haltbar ist, wenn man die enorme Kluft zwischen Armen und Reichen ignoriert. Ganz abgesehen von ihrer Seltsamkeit (eine Kommentatorin fragte sarkastisch: „Haben Sie jemals die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass [Amazon-Chef] Jeff Bezos einfach 130 Milliarden Mal härter arbeitet als Sie?“) stellt diese Vorstellung das Selbstwertgefühl von Arbeitnehmern in Frage, insbesondere solchen der unteren sozioökonomischen Schichten, und ignoriert andere Faktoren wie die Umwelt komplett.
„Ich bestreite nicht, dass manche Menschen produktiver sind als andere und dass sie besser bezahlt werden müssen – manchmal sehr viel besser. […] Die eigentliche Frage ist, ob das derzeitige Maß der Unterschiedlichkeit gerechtfertigt ist.“
Der Finanzmogul Warren Buffett wird oft mit diesen Worten zitiert: „Wenn Sie mich mitten in Bangladesh oder Peru oder sonst wo einpflanzen, werden Sie feststellen, wie viel dieses Talent in dem falschen Boden hervorbringt. […] Ich arbeite in einem Marktsystem, das zufällig sehr gut belohnt, was ich mache – überproportional gut.“
Für Buffett ist es gut gelaufen. Aber wenn abhängige Beschäftigte für Mindestlohn und mit begrenzter Arbeitsplatzsicherheit jeden Tag viele Stunden arbeiten und keine realistische Hoffnung haben können, etwas an dieser Situation zu ändern, wie sollen sie sich selbst dann sehen? Die Vorstellung von sozialer Mobilität, die Anhänger der freien Marktwirtschaft verfechten, beinhaltet laut Chang, dass alle diese Bedingungen akzeptieren, weil „ihr eigenes Kind der nächste Thomas Edison, J. P. Morgan oder Bill Gates sein könnte“. Das ist jedoch eine Fantasie, die selbst eine idyllische freie Marktwirtschaft nicht trägt. Nicht alle können reich sein. Ungleichheit ist im kapitalistischen System eingebettet. Wahrscheinlich ist sogar wahr, dass Ungleichheit das erfolgreichste Produkt des Kapitalismus ist.
Das beste System?
Kurz, die ausschließliche Fixiertheit auf Gewinn und der Glaube an das wohltätige Wirken des Eigennutzes stehen der Menschlichkeit in so vielen Dingen entgegen. Dennoch bleiben viele dabei, dieses System zu verfechten. Selbst Chang, der dessen viele Exzesse kritisch sieht, glaubt, „dass der Kapitalismus noch immer das beste Wirtschaftssystem ist, das die Menschheit erfunden hat.“
Es wird nicht einfach sein, die Prioritäten des Kapitalismus zu ändern, wie der Business Roundtable vorschlug – nicht zuletzt, weil er eine scheinbar logische Folge der Prinzipien und Ideale ist, auf die unsere Gesellschaften den größten Wert legen. Über die „rationalen“ Aspekte des modernen Kapitalismus, wie er sich in der gesamten westlichen Welt seit (und weitgehend infolge) der Reformation entwickelte, und das Arbeitsethos, das er mit sich brachte, hatte Weber eine Menge zu sagen. Milton Friedman sah Marktwirtschaft als die offensichtliche, logische Schlussfolgerung für jeden frei denkenden Menschen: „Sie erlaubt Einmütigkeit ohne Einheitlichkeit; […] sie ist ein System effektiv proportionaler Repräsentation.“ Rationalität und Demokratie – sind sie nicht das, was die westliche Gesellschaft am höchsten schätzt?
Und doch sind die Ergebnisse der freien Marktwirtschaft so enttäuschend. Die Ungleichheit der Vermögensverteilung, um ein Beispiel zu nennen, ist erschütternd. Ende 2019, so der Global Wealth Report 2020 der Credit Suisse, „entfielen auf Millionäre, die einen Anteil von genau 1 % der erwachsenen Weltbevölkerung darstellen, 43,4 % des weltweiten Nettovermögens. Dagegen entfielen auf die 54 % der Erwachsenen mit Vermögen von unter 10.000 USD zusammen weniger als 2 % des weltweiten Vermögens.“
Entgegen den Versprechungen von Politikern sind die Reichtümer nicht nach unten durchgesickert, und der Traum von sozialer Mobilität scheint in immer weitere Ferne zu rücken. Dies hat ungeheuer schädliche Auswirkungen für aufstrebende Volkswirtschaften gehabt, beispielsweise in Russland und ganz Afrika. Die Folgen für unser psychisches Wohlergehen sind unermesslich, und so ist es vielleicht kein Wunder, dass wir derzeit eben nicht die Früchte eines Systems genießen, das angeblich den größten Nutzen für alle schafft, sondern in einer Zeit leben, die manche eine Zeit der Sorge und Empörung nennen.
„In der Gesamtschau der 34 untersuchten Länder antwortete ein Median von 65 % der Erwachsenen auf die Frage nach der Verringerung des Gefälles zwischen Armen und Reichen in ihrem Land, sie seien generell pessimistisch.“
Der Schluss scheint unvermeidlich, dass der Kapitalismus die Bedürfnisse der Menschheit völlig falsch eingeschätzt (oder vielleicht ignoriert) hat, und der Business Roundtable und andere beginnen, dies zu erkennen. Allerdings wurde seine Erklärung von 2019 alsbald in Zweifel gezogen und sogar kritisiert.
Sollten Unternehmen sozial verantwortlich handeln, sollten sie für die Bedürfnisse ihrer Angestellten sorgen, sollten sie auf Bedürfnisse und Forderungen der Öffentlichkeit eingehen? Sollten sie, freiheraus gesagt, Rücksicht auf die Menschen nehmen? Der Trend bewegt sich in Richtung „ja“, im Widerspruch zu der Theorie der freien Marktwirtschaft, die seit so vielen Jahrzehnten vorherrscht. Ironischerweise ist es der Markt, der diesen Trend angestoßen hat; die Medien – die traditionellen wie die sozialen – haben Unternehmen gezwungen, ihre Politik zu ändern. Smithfields Coronaproblem wäre wahrscheinlich ohne Mediendruck nicht so früh bekannt geworden.
Eine rücksichtsvollere Vorgehensweise könnte durchaus Vorteile bringen, doch ob das ausreichen wird, darf bezweifelt werden. Schließlich ist der Kapitalismus, wie gesagt, mit einigen der wichtigsten Werte der heutigen Welt verbunden, von der Demokratie bis zur Rationalität. Man kann sich kaum eine Aktivität in der westlichen Welt vorstellen, die keine kapitalistischen Prinzipien in ihren Genen hat. Selbst im traditionellen Christentum, wo man vielleicht erwarten würde, dass Eigennutz nicht empfohlen wird, werben bestimmte populäre Gruppierungen für ein „Wohlstandsevangelium“: Wohlstand und Gesundheit sind für alle, die genug Glauben haben, garantiert – nachgewiesen unter anderem durch finanzielle Zuwendungen an die jeweilige Gruppierung oder deren Prediger.
Tatsächlich haben viele im Laufe der Jahre bei den glühendsten Verfechtern des Kapitalismus etwas wie religiösen Glauben gesehen. Eugene McCarraher von der Rutgers University beschreibt den Kapitalismus als „die Religion der Moderne“ und „das Evangelium von Wohlstand und seine Verheißung einer vergoldeten Erlösung“. Walter Benjamin bezeichnete den Kapitalismus als „eine reine Kultreligion, vielleicht die extremste, die es je gegeben hat“, und die Journalistin Naomi Klein nannte ihn „die Religion der freien Marktwirtschaft“ und einen „fundamentalistischen Glauben“.
Hier sei jedoch gesagt, dass die Bibel eine solche Religion nicht stützen würde. Bei aller Menschenfreundlichkeit ist der Kapitalismus doch nicht dafür bekannt, dass er verficht, was die Bibel „das zweitgrößte Gebot“ nennt: die Pflicht, andere und ihre Bedürfnisse ebenso wichtig zu nehmen wie unsere eigenen. Tatsächlich widerspricht die Bibel vielen Kernprinzipien des Kapitalismus: dass Wohlstand das Gleiche sei wie Erfolg, dass Eigennutz allen zugutekomme, dass Gewinn bis ins Unendliche maximiert werden solle, dass Nächstenliebe eine Option sei, aber keine Notwendigkeit, oder dass es im Leben primär darum gehen solle, sich materielle Dinge anzueignen. Tatsächlich warnt genau dieses Buch vor der endgültigen Vernichtung eines Systems von Kaufen und Verkaufen, das für den Kapitalismus, den wir heute kennen, wohl bezeichnend ist.
Die besorgniserregenden Folgen der freien Marktwirtschaft sollten uns wirklich zu denken geben. Sie ist eindeutig kein System, das allen Nutzen bringt. Smithfield war in einem unlösbaren Dilemma, zerrissen zwischen den Prinzipien der freien Marktwirtschaft, auf denen sein Erfolg beruht, und den Interessen der Arbeitnehmer. In dieser Pandemie haben andere Unternehmen zu Tausenden in einer ähnlichen Klemme gesteckt.
Die Frage, die wir stellen müssen, lautet: Sollten wir uns nach etwas Besserem umsehen?
McCarraher hält das für geboten. Er fragt, was geschehen könnte, wenn sich die Gesellschaft gegen das System wenden würde: „Was, wenn die Verlierer der Marktwirtschaft sich weigern, ihre Gebote zu akzeptieren […] ? Was, wenn sie sich den Anordnungen des Marktes und seinem unberechenbaren, unerklärlichen Willen gotteslästerlich verweigern?“ Ähnliche Zweifel hegte die britische Schriftstellerin, Journalistin und Kritikerin Rebecca West an dem System; sie schrieb in Black Lamb and Grey Falcon (1941): „[Der Kapitalismus] ist doch nicht annähernd so gut wie das, was wir für uns selbst wollen; man kann ihn doch nur mit Enttäuschung betrachten.“
Wie McCarraher bemerkt, hat der Kapitalismus als säkulare Religion „die Welt in ein Geschäft verwandelt“ und uns überzeugt, dass es keine bessere Alternative gibt. Zu diesem Zweck hat er „einen Blitzkrieg gegen utopische Spekulation geführt, mit dem Ziel, die Fähigkeit zu sabotieren, von einer Welt jenseits des Kapitalismus auch nur zu träumen“. Doch die Kritiker des Systems träumen trotzdem. Klein hofft auf „ein neues zivilisatorisches Paradigma“. McCarraher stellt sich eine Zeit vor, in der „Arbeit nicht nach Geld buddelnde Plackerei in räuberischem Streben nach Steigerung der ,Produktivität‘ wäre, sondern vielmehr die Versorgung und Förderung von Menschen.“
Zweifellos werden wir eines Tages das Ende des Kapitalismus erleben; kein von Menschen erdachtes System kann ewig bestehen. Tatsächlich mutet die Vision, die diese Kritiker des derzeitigen Systems beschreiben, sehr ähnlich an wie jenes „zweite große Gebot“, wenn es umgesetzt würde: eine Welt, wo die Bedürfnisse aller im Denken der Menschen ganz vorn stehen und wo deshalb Gewinnstreben nicht die treibende Kraft sein wird. Ein solcher Tag kann nicht zu bald kommen.