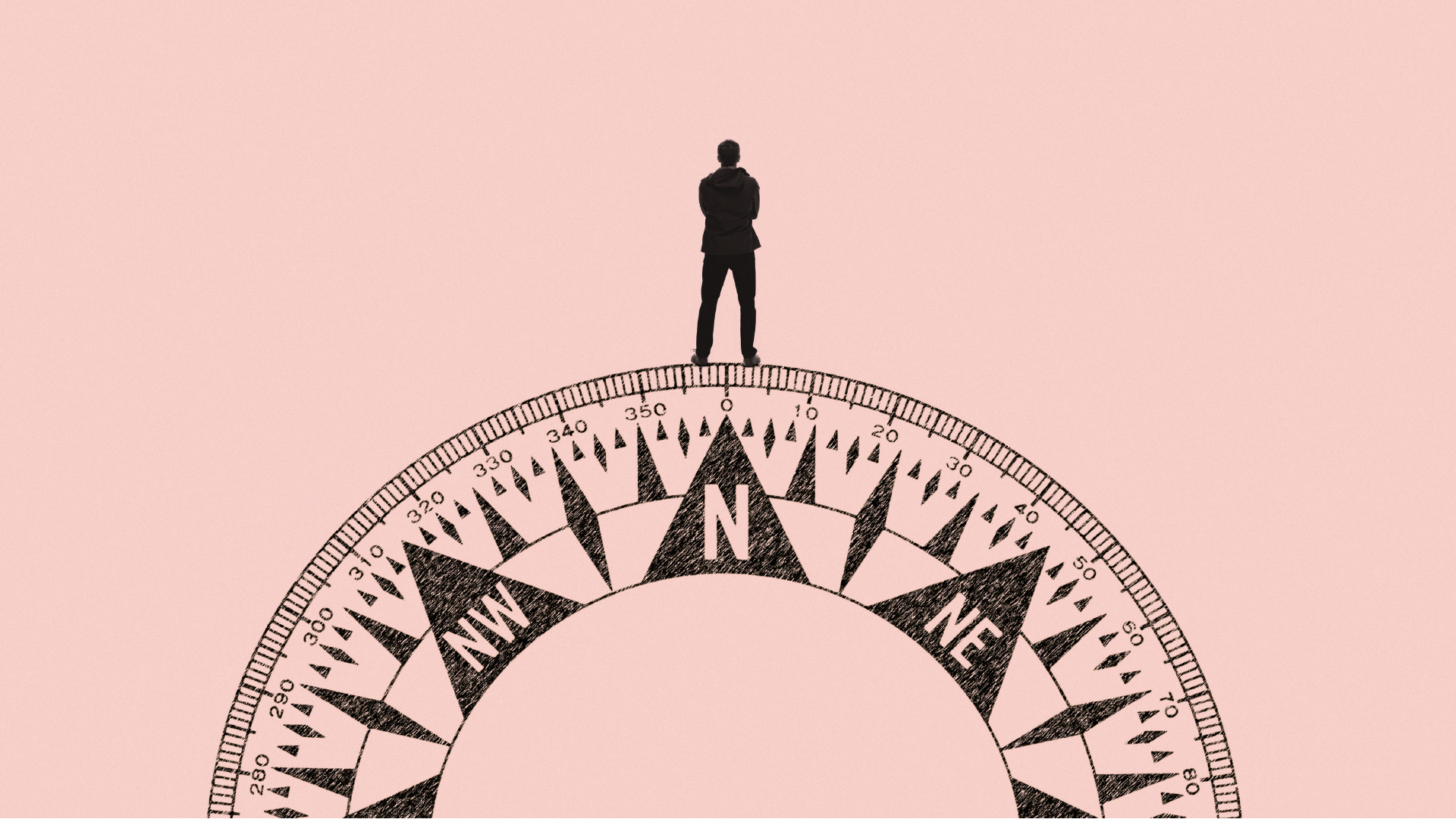Hat der Mensch einen Sinn für Moral?
Was motiviert uns, andere so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten? Ist das eine Fähigkeit, die wir erlernen müssen, oder werden wir mit einem Sinn für Moral geboren? Wenn ja, wie weit kann er uns bringen?
Mark Twain empfahl einmal einer Gruppe junger Leute: „Tut immer das Richtige. Das wird einige Leute freuen und den Rest überraschen.“
So reizvoll die Vorstellung sein mag, Leute zu überraschen – zu definieren, was richtig ist, ist jedoch nicht so einfach, wie es klingt. Dem Thema widmen sich große Forschungsbereiche, die mit Begriffen wie Ethik oder Moralphilosophie beschrieben werden. Über Jahrtausende haben zahllose Philosophinnen und Philosophen ganze Bibliotheken mit Büchern darüber gefüllt und dennoch nicht den zentralen Grundsatz aus der Bergpredigt Jesu verbessert: „Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch“ (Lukas 6, 31).
Eine ähnliche Vorstellung brachte auch der Philosoph und Theologe Albert Schweitzer zum Ausdruck: „Wahrhaft ethisch ist der Mensch nur, wenn er der Nötigung gehorcht, allem Leben, dem er beistehen kann, zu helfen, und sich scheut, irgendetwas Lebendigem Schaden zuzufügen.“ Bis zu einem gewissen Maß verstehen wir, was es bedeutet, anderen zu helfen oder Schaden zuzufügen, weil wir uns vorstellen können, was uns das Gefühl gibt, dass man uns hilft oder Schaden zufügt.
Aber reicht unser Gefühl dafür, wie wir behandelt werden möchten, um all die moralischen Fragen zu beantworten, die uns begegnen? Natürlich können persönliche Vorlieben und kulturelle Unterschiede einen Einfluss darauf haben, wie wir behandelt werden möchten, aber was kann uns dazu bringen, anderen gegenüber das Richtige zu tun? Ist es etwas, das wir einfach lernen müssen, oder werden wir mit einem Sinn für Moral geboren? Wenn ja, wie weit kann er uns bringen?
Manche dieser Fragen dürften vielleicht besser den Gelehrten in Philosophie und Theologie überlassen bleiben, doch wir alle haben mit moralischen Konflikten zu tun. Ob fromm oder Skeptiker, in irgendeiner Weise möchten wir alle uns selbst in einem guten Licht sehen. Wir möchten denken, dass wir Gut und Böse unterscheiden können – dass wir tatsächlich moralisch sind – und die meisten würden akzeptieren, dass ein Glaube an Gott keine Voraussetzung dafür ist. Ein kurzer Blick auf die Nachrichten des Tags zwingt uns, die Richtigkeit dieser Sicht anzuerkennen. Manche Menschen, die religiös sind, haben nicht, was man als hohe moralische Standards bezeichnen könnte, und Menschen mit hohen moralischen Standards sind nicht immer religiös. Das soll nicht heißen, religiöse Texte hätten, wenn es um Moralvorstellungen geht, nicht viel zu bieten – das haben sie. Das Problem ist, dass manche, die angeblich an sie glauben, nicht unbedingt nach ihnen leben. So fasste Jesus die Zehn Gebote der Bibel in zwei Gebote zusammen: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Doch selbst bei denen, die behaupten, sich an das Erste zu halten, lässt oft wenig auf das Zweite schließen.
Dennoch haben religiöse Texte die geschichtliche Entwicklung der moralischen Standards in der Gesellschaft mitgeprägt. Selbst wenn ihre Prinzipien nie überall galten, haben sie wesentliche Beiträge zum Diskurs über Moral geleistet.
Seit einigen Jahrzehnten beteiligt sich auch die Moralpsychologie an der Diskussion. Sie erforscht vor allem, wie Menschen entscheiden, was gut und was böse ist, während es in Philosophie und Theologie eher darum geht, was gut und böse ist. Beide Wissenschaften haben natürlich gemeinsame Interessen – und eines von ihnen ist die Frage der Motivation. Was hält uns auf dem „Pfad der Tugend“? Warum wollen Menschen feststellen, was das Richtige ist, und es tun?
Man könnte sagen, es beginnt alles mit unserem angeborenen Bedürfnis nach emotionaler Verbundenheit. In der Motivationsforschung zeigt sich, dass Emotion mit unserem Denken zusammenwirkt, wenn sie zu moralischem Handeln anregt. Diese Verbindung hat Jesus offenbar anerkannt, als er sagte: „Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten“ (Johannes 14,15). Aus dieser Sicht manifestiert sich die Empfindung, jemanden zu lieben (eine multidimensionale Emotion, die auch Empfindungen wie Mitgefühl und Loyalität umfasst), indem man Zuwendung, Fürsorge und Treue zeigt.
Motivation zur Moral
Wir sind von Geburt an soziale und emotionale Wesen. Das bedeutet, wir haben einen natürlichen Drang, uns auf emotionaler Ebene sozial mit anderen zu verbinden. Unsere Fähigkeit zur Empathie ermöglicht es uns, das zu tun, und deshalb erforscht die Neurowissenschaft seit Langem, wie es im menschlichen Gehirn „verdrahtet“ sein könnte. Als italienische Wissenschaftler in den 1990er-Jahren die Spiegelneuronen entdeckten, erregte dies großes Aufsehen, und deren Rolle wurde in daran anschließenden Forschungen weiter erhellt. Wie sich zeigte, aktivieren diese Neuronen bestimmte Gehirnareale, nicht nur wenn wir selbst etwas tun, sondern auch wenn wir zusehen, wie andere das Gleiche tun. Diese Beobachtung hat viele Wissenschaftler zu dem Schluss geführt, dass sie den Sitz der Fähigkeit unseres Gehirns zur Empathie gefunden haben – der Fähigkeit, uns mit dem Empfinden und Erleben eines anderen zu identifizieren.
Einfach ausgedrückt können Spiegelneuronen uns ein Fenster zur inneren Welt der anderen geben, sodass wir uns auf sozialer wie auch emotionaler Ebene empathisch verbinden können. Und dieses Fenster öffnet sich offenbar früh – tatsächlich von frühester Kindheit an.
Der Psychologieprofessor Paul Bloom von der Universität Yale wurde durch sein Interesse an moralischem Verhalten neugierig darauf, wie viel von unserem Sinn für Moral angeboren sein könnte. Er hat über Babys und kleine Kinder geforscht, um zu sehen, wie sich unser Gefühl für Gut und Böse entwickelt. Im Lauf seiner Karriere haben er und seine Kollegen eindrucksvolles Beweismaterial dafür gesammelt, dass Babys und Kinder (ab etwa drei Monaten) tatsächlich etwas haben, das man einen Sinn für Moral nennen könnte. Sie können zum Beispiel erkennen, ob jemand lieb oder gemein ist. Sie mögen es nicht, Menschen leiden zu sehen, und versuchen, ihren Schmerz zu lindern. Sie legen Wert auf Fairness, auch wenn sie sie in einfachen Kategorien sehen (jeder bekommt gleich viele Rosinen), und ihr Gerechtigkeitsgefühl will, dass gute Taten belohnt und schlechte bestraft werden.
„Unsere angeborene Güte ist allerdings begrenzt“, schreibt Bloom, „manchmal tragisch begrenzt. […] Wir sind Fremden gegenüber von Natur aus gleichgültig, sogar feindselig; wir neigen zu Engstirnigkeit und Bigotterie. Einige unserer instinktiven emotionalen Reaktionen, allen voran Abscheu, treiben uns zu entsetzlichen Taten bis hin zu Völkermord.“
„Ein Sinn für Moral […] ist nicht das Gleiche wie ein Impuls, Gutes zu tun und Böses nicht zu tun. Er ist vielmehr die Fähigkeit, bestimmte Dinge zu beurteilen – zwischen Gut und Böse, Güte und Grausamkeit zu unterscheiden.“
Es ist versucht worden, diesen Tendenzen mit dem Appell entgegenzuwirken, man solle seinen „Moralkreis“ erweitern – die Gruppe, die man als würdig empfindet, moralisch berücksichtigt zu werden. Wie Bloom aufgezeigt hat, kann man Fremden gegenüber engstirnig und gleichgültig sein, gleichzeitig aber gegenüber der eigenen Familie und engen Freunden Fürsorge zeigen. Wie weit der Moralkreis reicht, variiert von Mensch zu Mensch. Das liegt an mehreren komplexen Dynamiken. Doch um die Vorstellung zu vereinfachen, können wir an die Wellenkreise denken, die entstehen, wenn man einen Stein in einen Teich wirft. Wir selbst sind die Mitte, am nächsten dazu der Familienkreis, dann stehen weitere Kreise für Freunde, unser soziales Umfeld, das Land, in dem wir leben, alle Menschen – und potenziell sogar Tiere, alles Lebendige und das Universum selbst.
Wenn man seinen Moralkreis erweitert, könnte man zu Verhaltensweisen kommen, die zukünftigen Generationen zugutekämen (indem man zum Beispiel sein Möglichstes tut, um Existenzbedrohungen zu begegnen). Aber irgendwann beginnt bei den meisten Menschen eine mehr nach innen strebende Kraft zu wirken – und dann ist man nicht fähig (oder nicht willens), seinen Moralkreis noch weiter auszudehnen.
Es gibt allerdings Methoden, die Bereitschaft zu einer solchen Erweiterung zu fördern. Eine von ihnen ist Mitgefühlsmeditation. Wie Hirnscans zeigen, kann sie signifikante Veränderungen in den bei konzentrierter Aufmerksamkeit und Empathie aktiven Hirnregionen bewirken und helfen, die Sicht anderer besser nachzuvollziehen und zu angemessenen moralischen Bewertungen zu kommen. Man kann Mitgefühlsmeditation praktizieren, indem man sich die Zuwendung und Fürsorge vorstellt, die man für einen nahestehenden, geliebten Menschen empfindet, und dieses gleiche Gefühl dann auf eine Person anwendet, die in den konzentrischen Wellen seines Moralkreises weiter außen steht. Wenn wir unser Denken und Fühlen so trainieren, indem wir uns auf die Emotionen konzentrieren, die unsere besseren Absichten stärken, kann dies dazu beitragen, Liebe, Respekt, Mitgefühl, Dankbarkeit und ein allgemeines Gefühl des sozialen Dazugehörens zu kultivieren – einige der vielen positiven Emotionen, die zu produktivem Verhalten motivieren.
Allerdings ist klar, dass Motivation zu moralischem Verhalten weit mehr ist als einfach das Erzeugen positiver Emotionen. Schließlich rekrutieren und motivieren Randgruppen – von Incels bis zu Terroristen – ihre Anhänger, indem sie ihnen ein Gefühl des Dazugehörens anbieten, das in deren gewohntem Umfeld oft fehlt. Unser Bedürfnis nach dem Dazugehören ist machtvoll. Wir haben einen starken Wunsch, denen zu gefallen, die wir respektieren und mögen, und zu wissen, was sie von uns halten. Wir wollen das Gefühl haben, dass sie unser Verhalten gut finden – tatsächlich so sehr, dass wir es manchmal ändern, um uns ihr Wohlwollen zu bewahren. Dies ist einer der Mechanismen hinter dem Phänomen Anpassungsdruck – und auch er kann positiv oder negativ für uns sein.
„Es ist emotional strapaziös, gegen soziale und moralische Regeln zu verstoßen.“
Das Gleiche lässt sich über die negativen Emotionen sagen, die mit moralischem Verhalten zusammenhängen. Abscheu, Verlegenheit, Schuldgefühl, Scham, Trauer, Reue – jede von ihnen kann Verhalten positiv oder negativ motivieren. Und obwohl „transzendente“ Emotionen wie Ehrfurcht und Verehrung oft für religiöse Begriffe gehalten werden, die nur moralisch einwandfreie Motivationen beschreiben können, erinnert man sich leicht an Beispiele, bei denen jede dieser Emotionen zu entschieden amoralischen oder unmoralischen Taten geführt hat. Seit Menschengedenken sind zum Beispiel Heldenverehrung und Selbstgerechtigkeit treibende Kräfte zu Krieg und Völkermord.
Allerdings bestätigt die Forschung über Psychopathen, dass auch negative Emotionen eine Schlüsselrolle bei der moralischen Urteilsfindung spielen können. Weil Psychopathen selten selbst negative Emotionen wie Furcht und Traurigkeit erleben, tun sie sich schwer, diese bei anderen zu erkennen. Deshalb sind sie unfähig, das Leid von anderen mitzufühlen. Das erklärt, warum sie kein echtes Schuldgefühl oder Reue empfinden, wenn ihr Verhalten anderen Schmerz zufügt. Ohne Empathie bedeutet der Begriff „Unrecht“ wenig mehr als vielleicht „gesetzlich verboten“. Die innere Motivation, das Richtige tun zu wollen, ist nicht vorhanden, wenn man sich die Folgen seines Handelns für den emotionalen Zustand der anderen nicht vorstellen kann und sich nicht dafür interessiert.
Empathie hilft also, die eigenen Emotionen so einzusetzen, dass man andere so behandeln kann, wie man selbst behandelt werden will. Aber nach dieser Empathie zu handeln, erfordert oft einen weiteren gut erforschten Wesenszug: Selbstbeherrschung.
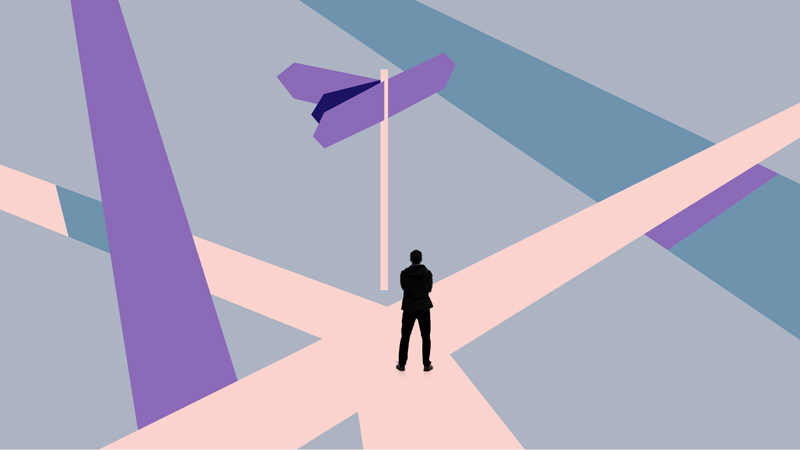
Selbstbeherrschung: Der Faktor Empathie
Die Forschung hat eine Fülle von Beweisen für einen Zusammenhang zwischen Empathie und Selbstbeherrschung gefunden. Mit diesen Wesenszügen sind bestimmte Hirnregionen verbunden, und jede wird von den Beziehungen mit betreuenden Personen in der Kindheit beeinflusst. Mit anderen Worten: Diese Wesenszüge, die für die menschliche Moral so grundlegend scheinen, sind sowohl anlage- als auch umweltbedingt. So, wie qualitativ gute Beziehungen die Gehirnareale vergrößern und stärken, die für Empathie und Selbstbeherrschung bestimmend sind, erweitern sie auch unsere moralische Identität. Wir sind darauf angewiesen, dass die Menschen, die uns lieben und versorgen, unserem Verhalten angemessene Grenzen setzen und uns die Feinheiten eines pflichtbewussten, verantwortungsvollen Charakters vermitteln.
Dabei kann man dem Irrglauben verfallen, Selbstbeherrschung bedeute, Emotionen zu unterdrücken. Manchmal kann es den Anschein haben, dass Emotionen der Feind sind, den es zu überwinden gilt, der schwache Teil unseres Systems, der uns für ein Abrutschen in verantwortungsloses Verhalten anfällig macht. Man hört generell über den präfrontalen Cortex als den Sitz der Selbstregulierung, den „Whistleblower“, der Impulsivität im Keim erstickt. Doch wie in den Ausführungen über Psychopathen angesprochen ist unsere Fähigkeit zu Emotionen entscheidend für unsere Fähigkeit zu Empathie – und sie ist der Weg zu den moralischen Bewertungen, die unser Verhalten beeinflussen.
Die Lehre hieraus ist klar: Der präfrontale Cortex ist nicht die einzige Struktur, die wir nutzen, um uns zu regulieren oder uns für langfristige statt sofortige Belohnungen zu entscheiden.
Eine Forschungsgruppe, die ein Hirnareal bearbeitet, das unter anderem für seine Rolle bei sozialen Prozessen und aktiver Empathie bekannt ist, hat etwas sehr Interessantes festgestellt: Dieses Hirnareal wird nicht nur aktiviert, wenn wir unser Verhalten mit Rücksicht auf andere Menschen regulieren (wie natürlich zu erwarten sein dürfte), sondern auch wenn wir unser Verhalten mit Rücksicht auf unser eigenes künftiges Ich regulieren. Empathie erfordert natürlich die Fähigkeit, sich die Perspektive eines anderen vorzustellen. Aufgeschobene Befriedigung, die als zentraler Aspekt von Selbstbeherrschung gilt, erfordert das Gleiche, nur dass „ein anderer“ auch die künftige Version unserer selbst sein kann – eines Menschen, dessen Bedürfnisse und Perspektiven andere sein werden als unsere heutigen.
Wenn wir an Situationen denken, in denen wir moralisch versagt haben – obgleich wir von uns selbst und anderen als moralische Menschen gesehen werden wollen –, können wir sehen, warum der Zusammenhang zwischen Empathie und Selbstbeherrschung so wichtig ist. Natürlich verhalten wir uns trotz aller mitfühlenden Intentionen, die wir aufbringen können, manchmal nicht in Einklang mit unseren Überzeugungen. Wir verletzen nicht nur Unbekannte, sondern auch Menschen, die wir lieben – bei denen wir starke emotionale Gründe haben, sie zu schützen und uns um sie zu kümmern.
Man nennt es kognitive Dissonanz, wenn Überzeugungen und Verhalten nicht zusammenpassen. Eine ähnliche Dissonanz besteht, wenn unsere moralischen Intentionen und unser Verhalten nicht zusammenpassen. Eine Gruppe von Verhaltensforschern, die über Moral forscht, hat festgestellt: „Menschen begehen oft Verfehlungen, selbst wenn sie erkennen, dass ihr Handeln ,unmoralisch‘ ist.“ Dies geschieht zum Beispiel, wenn eine stärkere Emotion die Oberhand über die Emotion gewinnt, auf der unser Moralstandard beruht. Unser Standard kann sein, dass man Freundinnen oder Freunde nicht belügen darf, aber die Befürchtung, sie könnten weniger von uns halten, wenn sie die Wahrheit wüssten, könnte uns dazu verlocken, in einer bestimmten Situation diesen Standard zu ignorieren. Dann mildern wir die Dissonanz, die wir empfinden, durch Strategien, die diese Forschungsgruppe „moralische Abspaltung“ nennt, indem wir unser Handeln rechtfertigen, vielleicht indem wir die Folgen unseres Verhaltens minimieren oder auf andere Weise falsch darstellen. Es kann sogar vorkommen, dass wir unser problematisches Verhalten rechtfertigen, indem wir andere entmenschlichen oder ihnen die Schuld in die Schuhe schieben.
Schuldzuweisung und der Faktor Verantwortung
Wohin wir Schuld zuweisen, macht einen großen Unterschied dafür, wie wir unser Verhalten und unsere Bewertungen mit unseren moralischen Überzeugungen in Einklang bringen. Wer oft Unrecht erfahren hat, sieht die Schuld bei sich, auch wenn es gar nicht seine Schuld ist. Der Mensch, der ihm Unrecht getan hat, ist bestrebt, einem Schuldgefühl aus dem Weg zu gehen, und wendet die eben beschriebenen Techniken an, um das zu bewerkstelligen: Er entmenschlicht sein Opfer („er/sie hat es verdient oder wollte es so“), stellt die Folgen falsch dar („er/sie kommt schon darüber hinweg; er/sie ist ja nicht daran gestorben“) oder wälzt die Schuld auf andere ab („ich konnte nichts dafür; es war die Art, wie er/sie angezogen war“). Es kommt selten vor, dass Täter ihre Verantwortung akzeptieren, indem sie ihre Taten durch die gleiche Brille betrachten, wie andere Menschen es täten. Manchmal machen Beobachter den gleichen Fehler, geben Opfern die Schuld daran, dass sie zum Opfer gemacht worden sind, und entschuldigen den Täter. Fehler dieser Art sind moralische Verfehlungen nicht nur von Einzelnen, sondern auch der Gesellschaft, die sie unterstützt.
Wenn man also Menschen für unmoralisches Verhalten zur Verantwortung ziehen will, was sind dann die Bausteine der Verantwortung?
Die Moralphilosophen Brendan Dill und Stephen Derwall betrachten zuerst, wie Beobachter und Täter auf moralische Verfehlungen reagieren. Kritische Haltungen wie Verachtung und Geringschätzung bewirken das Gefühl der Schande, schreiben sie, was zur Verinnerlichung von Schuld führt, aber nicht auf konstruktive Weise. Schuld als Schande zu internalisieren, ist keine wirksame Weise, etwas zu ändern. Schuldgefühl ist dagegen ein persönliches Anerkennen von Verfehlung, das viel wahrscheinlicher dazu führt, die Verantwortung zu übernehmen. In beiden Fällen geht es um Schuld, aber der Unterschied liegt darin, wie sie zum Ausdruck kommt und welche Emotion sie auslöst. Manche Emotionen sind besser geeignet als andere, zu moralischem Verhalten zu motivieren.
Wenn man weiß, dass man eine moralische Verfehlung begangen hat, und objektiv sich selbst die Schuld für dieses Unrecht gibt, ist Schuldgefühl die Emotion, die dazu motiviert, den Täter (sich selbst) dafür verantwortlich zu machen.
„Wie kann ein Täter sich selbst verantwortlich machen? Indem er sein Handeln in der gleichen Weise als verwerflich beurteilt, wie ein Außenstehender es täte, und darauf angemessen reagiert.“
Mit Verantwortlichkeit und dem Akzeptieren von Schuld verbunden sind Begriffe wie Reue und Vergebung. Diese Emotionen können zu moralischem Verhalten motivieren, das auch Wiedergutmachung und Versöhnung umfasst – Triebe, die man ebenfalls als angeboren betrachten könnte. Babys verstehen die Feinheiten von Reue und Vergebung wohl nicht, aber sie suchen durchaus aktiv Abhilfe, wenn sie einen Bruch der Verbindung mit ihren Bezugspersonen spüren. Sie können recht aufgeregt und ängstlich werden, wenn eine Bezugsperson verärgert oder gleichgültig erscheint, und versuchen oft aktiv, die Verbindung wiederherzustellen, indem sie ihre Arme ausstrecken.
Als Erwachsene sind wir in unserem Streben nach korrektem moralischem Bewerten natürlich mit vielen Hindernissen konfrontiert, aber es spricht genug dafür, dass der Mensch mit etwas wie einem rudimentären Sinn für Moral zur Welt kommt, der als angeboren gelten könnte. Wenn das zutrifft, dürfte es Argumente für einen moralischen Relativismus schwächen und Wörtern wie Werte und Ethik einen deutlich höheren Stellenwert geben als Geschmack oder Vorlieben. Das ist ein elementarer Unterschied. Unter anderem erkennt man dadurch moderne Beispiele menschlicher Unmenschlichkeit gegen andere Menschen als die Gräuel, die sie sind – als Verrat an der Menschlichkeit, nicht nur als die bevorzugten Praktiken einer bestimmten Kultur, die man sich entwickeln lassen kann, wie sie will.
Angesichts unserer eigenen Lebenserfahrung wie auch der Ereignisse, die wir tagtäglich um uns herum sehen, sollte klar sein, dass unser angeborener Sinn uns nicht alle Antworten zur Moral gibt, die wir brauchen, um uns durch unser Leben zu steuern. Um noch einmal Blum zu zitieren: „Unsere angeborene Güte ist allerdings begrenzt, […] manchmal tragisch begrenzt.“ Aber so unvollkommen sie ist, sollte sie uns wenigstens sagen, dass es beim Umgang miteinander Gut und Böse gibt, und uns zu der Selbstverpflichtung motivieren, festzustellen, was was ist.